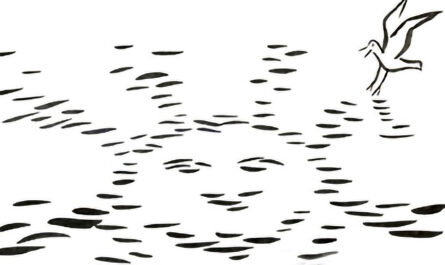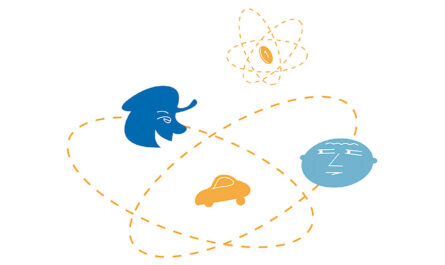Mai | Frühlingsgedankenflüge
• In der linden Einsamkeit des frühen Morgens liebte sie den Platz am See besonders. Schönheitstrunken glitt ihr Blick über den unbewegten Wasserspiegel, dessen Zauber die Pracht der umliegenden Berge verdoppelte. Mit Hingabe säuberte sie das alte Holz von Blütenstaub, als pflegte sie keine Sitzbank, sondern eine vertraute, zerbrechliche Freundin, und ein selbstvergessenes, verklärtes Lächeln umspielte dabei ihr greises Gesicht.
Dreiundsechzig Jahre waren vergangen. Vor genau dreiundsechzig Jahren hatte die Liebe ihres Lebens zu erblühen begonnen, an einem milden Maienmorgen, hier an diesem Platz, und ihrer zweifelnden Vernunft zum Trotz hätte sie jederzeit beschworen, es wäre just auf dieser Bank geschehen. Die verschmitzten Äugelchen im Holz, der bärtige Rost, der die Schrauben umsäumte, jedes Detail dieses Lebensmarksteines gehörte zum unveräußerlichen Mobiliar ihres gedanklichen Heims.
Hier war sie mit Alfredo ins Gespräch gekommen. Sie hatten nur sympathische Belanglosigkeiten ausgetauscht, aber nach einer glücklich hingeworfenen Bemerkung über die Ohnmacht des Schreibens gegenüber dem Zauber der Natur hatte der schwarzhaarige, blendend aussehende Brasilianer ihr die Hand zur Brieffreundschaft gereicht.
Tatsächlich war Alfredo seinem Vorhaben, jede Nachricht aus der Heimat seines Vaters sorglich zu erwidern, 57 Jahre lang treu geblieben. Von Brief zu Brief hatte sich ihre Bekanntschaft vertieft, war über die Schrift hinaus gewachsen; irgendwann hatte sie begonnen, ihm Tonbänder zuzusenden, selbst verfasste Prosa und Gedichte, kleine Herzenswerke, unbedeutend für die Welt, aber er hatte an dem sachten Faden angeknüpft und ihr seine Bänder übersandt.
Leidenschaftlich und naiv liebte sie seine sonore, väterliche Stimme, wie sie alle Klippen der deutschen Sprache zu sanften Hügeln melodierte und ihr Empfinden dabei wieder und wieder zurück auf diese Bank trug. Geradezu töricht beglückte sie sein Tasten nach Begriffen, wenn er sich redlich mühte, tiefere Beziehungswelten auszuloten.
Seine Lebensdokumente hatten ihr bald als kostbarster Schatz gegolten, aber erst spät, viel zu spät, hatte sich das traute Zueinanderstreben zur Liebe beschleunigt. Immer leidenschaftlicher hatte sie ihn zu kommen gedrängt, zunehmend ohne Verständnis für was auch immer ihn noch halten konnte, und endlich, endlich hatte er ihr den Tag genannt.
Hier an dieser Bank hätte ihre Zukunft beginnen sollen. Sie hätten nicht mehr nur Briefe und Bänder ausgetauscht, sondern andauernde Umarmungen, innige Küsse, stürmische Liebkosungen, wie es Menschen tun müssen, die nach Jahren der Reife endlich ihre Jugend finden.
Doch der Vorfreude ihres Lebens war keine Erfüllung gewährt.
Er war einfach nicht angekommen, und erst nach bangen Wochen hatte ihr ein Brief die erhoffte und gefürchtete Gewissheit in das Herz gebrannt. Nur ein paar knappe Sätze berichteten von seinem Tod. Ein fremder Brasilianer schrieb ihr, dass sein alter Freund endlich habe gehen dürfen, und wie tapfer er sein langes Leid erduldet habe.
Mit keinem Wort, nicht mit dem zartesten Wink hatte Alfredo sie an diesem traurigen Geheimnis Anteil nehmen lassen. Ob er es einfach kühn aus seinem, ihrem Schicksal zwingen wollte?
Immer noch malten ihre Finger Spuren in den feinen Schleier aus jungem Blütenstaub.
War eine Liebe, die so stetig angewachsen war, tatsächlich unerfüllt?
Das Wasser stand still und klar wie ihre Gedanken. Sie blickte hinaus auf den See und schaute Alfredo. Er war ihr nahe, sie spürte die Woge der Sehnsucht und Freude, wie sie noch einmal die Vergangenheit durchlichtete und sich dann hinaus in das Leben ergoss, um irgendwo an einem anderen Menschen anzulanden. –
– Lieber hätte sie die Bank für sich allein gefunden. Aber die Frau, die gedankenversonnen mit ihren Fingern über das Holz strich, wirkte sympathisch, und das Habit bewahrte ohnehin vor wahlloser Nähe. Sie würde sich zu ihr setzen, lächeln und schweigen.
Sie setzte sich, versäumte das Lächeln und vergrübelte sich sogleich in ihr schwermütiges Paradies.
Gewiss war es der Lohn aufrechten Glaubenseifers, dass sie den Abgrund ahnen durfte, der die Spreu vom Weizen trennte, der die lustvoll dahin gleitende Welt dem Gottesreich entriss. Vor verschlossenen Toren würden die Ungläubigen erstarren, Vergebung erflehen für ihre spöttischen Worte und jeden herablassenden Gedanken, mit dem sie die Dienerinnen Christi je behelligt hatten. Aber die Hand des Herrn würde hart sein und unerbittlich im Gericht. Ja, doch, sie würde Mitleid fühlen mit manchem einst vertrauten Menschen, aber die alten Kreise ihrer Familie, ihrer Freundinnen und Bekannten zerbrachen längst in weiter Ferne. Letztlich würde sie ohne Regung auf das Verworfene hinüber blicken können.
Immer noch bestarrte ihre sonderbare Nachbarin den stillen See mit ihrem anspruchslosen Lächeln. Ob sie wohl zu den Geretteten im Leibe Christi zählte? Ob eine solche Frau würdig für das Himmelreich sein konnte, obwohl kein festes Tuch sie vor dem Alltagsdünkel schützte? Gab es eine Möglichkeit, die Gotteskindschaft zu erkennen, ein geheimes Zeichen, das jeder Glaubensschwester eingeritzt ins Antlitz ist?
Vielleicht durfte, musste sie dieser suchenden Seele Heilswegweiser sein. Vielleicht sollte die Begegnung hier auf dieser Bank ihr die Erlösung bringen, und diese demutsvoll in sich gekehrte, von den Wehen des Lebens schon vorbereitete Frau könnte bald im Glauben neu geboren werden. Ja, sie würde den sanften Fingerzeig des Herrn, der sich in der Wenigkeit seiner Dienerin offenbarte, glücklich erkennen!
Die Glut eifernder Empfindungen durchstöberte ihre Gedanken, alle Blicke, mit denen sie nun in der Gunst der körperlichen Nähe nach der Suchenden tastete. Schon wollte sie das Netz des freundschaftlichen Grußes nach ihr werfen, aber das Leuchten in den Augen der Nachbarin gebot dieser Zumutung Einhalt, und die kunstvoll gefertigte Anteilnahme, die hinüber zu der entrückten Fremden fließen sollte, wurde von einer unsichtbaren Gewalt zurück gespült.
Die Finger der glückseligen Frau beendeten ihr Spiel mit dem zarten Blütenstaub, ein entschlossener Ruck durchfuhr ihren Körper, leichtfüßig stand sie auf, wandte ihren verklärten Blick der Nonne zu und verriet frohgemut, sie wolle an diesem besonderen Tag noch ein Stück um den See wandern.
„Gott sei mit Ihnen“, gab ihr die Glaubensschwester mit auf den Weg; ein kärglicher Zuruf, der sich aus ihrem erstarrten Gedankengetümmel noch hatte befreien können.
Erst als die heitere Alte auf dem Seeweg hinter der Bank in den Schatten des Waldes getaucht war, erwachte die Ordensfrau aus ihrem Staunen, und bald fühlte sie deutlich, wie am Strand ihrer fort gespülten Absichten unverhofft etwas anlandete.
Die Woge der Sehnsucht und der Freude.
Ungestüm drängte ihr Empfinden nun, gereizt von dieser Macht, einem geliebten Menschen zu, der schon lange hinter dem Gemäuer ihres Glaubensfleißes darbte. Sie hatte ihn vergessen wollen, aber die Geschwisterbande hatten sich als stark und fest erwiesen, und das heitere Gemüt des Bruders konnte sie gewiss noch heute zu ausgelassenem Genuss verlocken. Er hatte ihren Weg des Glaubens nie nachvollziehen können. Wie es ihm wohl ging?
Hier und jetzt, nach Jahren des Schweigens und Mutmaßens, entschloss sie sich, ihm einen Brief schreiben. Ja, sie durfte, sollte dieses Tor zur gottesfernen Welt mit ein paar sorglich formulierten Zeilen öffnen. Sie würde damit nichts Verwerfliches tun, sie würde Liebe schenken und vielleicht auch neu empfangen.
Schon eilten die Erinnerungen, und in wachsendem Vergnügen nahm sie ihr stets sauber verwahrtes Notizheft zur Hand. Aber ehe sie zu schreiben begann, vergegenwärtigte sie sich in einer kunstvoll geführten Skizze ihren Bruder, der an diesem Tag auf dieser Woge aus dem Vergessen wiederkehrte. –
– Nachdenklich schritt er den Seeweg entlang, um sich selbst noch einmal neu zu finden.
Was wusste er von seinem Vater, der nun beerdigt worden war? Wenn er auf die 35 Jahre seines Lebens zurück blickte, so zeigte ihm der Spiegel der Vergangenheit immer nur ihn und wieder ihn selbst, seine eigenen Ängste und Träume, seine Siege und Niederlagen, die großen Erfolge und die kleinen dunklen Geheimnisse. Aber was wusste er von dem, der ihm den Weg bereitet hatte, der gewiss an allen Tagen mit ihm und um ihn gebangt, die entscheidenden Freuden und Leiden geteilt hatte?
Von jenem Menschen, der ihn gewiss besser gekannt hatte als er selbst sich je zu sehen vermochte, hatte er furchtbar wenig erfahren. In dem unseligen Wahn, nur die Jugend führe das gültige Leben, war er neben ihm her gegangen, freundlich, in familiärer Harmonie, aber ohne ihn zu würdigen. Er hatte durch eine beschlagene Brille auf seinen Vater gesehen, die ihm eine seltsam farblose Gestalt zeigte, die einzig noch dem Gestern zugehört.
Jetzt hatte dieser Mensch seinen Lebenskreis beschlossen. Nach langer Einsamkeit in den späten Jahren und geplagt von einem abgezehrten Körper hatte er endlich ausgeatmet, und war auch in diesem letzten Augenblick allein geblieben. Keine tränenverklärte Umarmung hatte ihm die Liebe seines Sohnes bezeugt, keine Hand die seine umfasst, um einen schwachen Gegendruck für Jahrzehnte der Fürsorge zu bieten. Still hatte der Vater in dem kahlen, dunklen Sterbezimmer sein Leid ertragen, vielleicht auch seinen Schmerz, denn zu klagen wäre ihm als würdelos erschienen.
Wie er sich selbst in dieser Stunde einst wohl zeigen würde? Bereit und stark genug, sein Schicksal ganz dem Wind des Lebens hinzugeben und die Gedanken, vom verlebten Sein schon losgelöst, nur seinen Liebsten zuzueignen?
Sein Blick fiel auf die alte Holzbank abseits des Weges, direkt am Ufer des Sees. Er hielt inne und beobachtete die Nonne, die hektisch ihren Notizzettel bekritzelte, als wolle auch sie die Gespinste ihres Lebens ordnen und entwirren. Er lächelte über seinen Gedanken, hier womöglich eine Schicksalsschwester gefunden zu haben, und entschloss sich, den freien Platz neben der Ordensfrau für eine Rast zu nutzen.
Ein Wölkchen überzog ihr Gesicht, als sie seine Absicht bemerkte, dann aber nickte sie einladend zum Gruß. Ihm erschien die Frau in ihrem dunklen Habit nun noch mehr als Abbild seines Selbst. Wanderte sie nicht, wie er, eigenbrötlerisch auf einer Insel, fern vom Leben, im Schutz bequemer, ausgetretener Gedankenpfade?
Da entschloss er sich, diesen eigentümlich familiären Augenblick hier und jetzt einer Wende zu verbinden.
Es war zu spät geworden, der Liebe zum Vater den gehörigen Ausdruck zu verleihen. Aber da gab es noch jemanden, der darbte.
Er sah seine Tochter, wie sie sich jauchzend in seine Arme stürzte, sah sich mit ihr spielen, streiten, umhertollen, und ahnte sie zum Mädchen gereift, das freundlich auf ihren alten Vater hinabblickt und doch nur in der eigenen Jugend das gültige Leben erkennt.
Beglückt vom Zauber der Kindlichkeit betrachtete er das stille Ufer, um endlich, erschöpft vom Abschied, aber getrost in die Zukunft schauend, die Augen zu schließen, damit die Bilder des Sees und der Seele sich zum Traum vereinen konnten. –
Als er seine Reise erfrischt beendet hatte, saß eine streng gekleidete, üppig geschminkte Frau neben ihm, deren stechender Blick sinnlos gegen den Zauber des ermutigenden Sonnentages kämpfte. –
– Der Schläfer war also doch noch aufgewacht. Betont kurz erwiderte sie den höflichen Gruß ihres seltsam kindlich anmutenden Nachbarn, der sie keiner weiteren Ansprache würdigte und seinen Blick in Andacht auf den See gerichtet hielt, als säße er allein auf dieser Bank. Sie empfand seine Teilnahmslosigkeit als ungebührlich, verachtenswert und hätte es begrüßt, dieses Verhalten nicht noch länger ertragen zu müssen.
Ja, dachte sie, sie hätte diesem jungen Mann gut begründen können, weshalb sich Härte gegenüber allen trägen Nachgeborenen letztlich doch als Recht erweisen muss.
Irgendwann würde ja auch Melinda erkennen, dass Konsequenz und Strenge besser auf das Leben vorbereiten als die banale Affenliebe anderer Mütter. Immerhin hatte die Tochter ihr einen Weihnachtsgruß gesendet, erstmals nach Jahren. Aber es war richtig gewesen, nicht das Gleiche zu tun. Wenn ein Kind alles ihm Gebotene so selbstgefällig mit Füßen getreten hat, sollte Zuneigung nicht übereilt gespendet werden. Es war an Melinda, ihre sture Eigenwilligkeit reuevoll zu überwinden.
Wie unangenehm die Sonne blendete! Sie zog verärgert ein Feuchtigkeitstuch aus ihrer Tasche, betupfte die schwitzende Stirn und kontrollierte ihr strapaziertes Make-up im Handspiegel, während ihre Blicke zur Seite bissen und den anhaltenden Glanz in den Augen des Banknachbarn musterten. Verspieltes kleines Kind, unberührt von den Stürmen des Lebens, in selbstgefälliges Schweigen versunken, ohne Achtung für das Alter, wohl von Beginn an verzogen durch eine orientierungslos umherirrende Nachgiebigkeit, die sich Erziehung schimpft!
„Es ist wunderschön hier, nicht wahr?“, stellte er fest, als er ihre Forscherblicke auf sich lasten fühlte. Aber ehe sie etwas erwidern konnte, entflatterte der Baumkrone über der Bank in heftigem Getöse ein Vogelschwarm.
Unwillkürlich blickte sie zugleich mit ihm nach oben.
Er erkannte in dem Himmelsbild beseligt den Zauber des Loslassens. Frohgemut lächelte er ihr zu, zog launig eine Analogie zu seinem eigenen Aufbruch und erhob sich schließlich freundlich grüßend, während seine Gedanken den weiteren Weg schon entlang stürmten und alle Trübsal mühelos durchbrachen.
Sie nickte ihm verhalten zu und sah, vom Unerwarteten befriedet, den fernen Vögeln nach. Ihr Gemüt hatte den alten, affektierten Kerker verlassen, folgte dem Schwarm zum Licht und begegnete noch einmal allen Lebensrufen, die sie auf dem Weg zu dieser Bank begleitet hatten: Dem lachenden jungen Paar, das liebestrunken Hand in Hand Stock und Stein überfliegt … dem übermütig jauchzenden Lausejungen, der seinen Fuß mit aller Kraft in die weithin tiefste Pfütze rammt … der ungehemmt schluchzenden Mutter, die ihre Tochter im Überschwang der Wiedersehensfreude herzt …
Das Leben herrschte in stiller Kindlichkeit, und sie fühlte sich als farb- und stimmlose Statistin an den Wegrand gepflügt.
Nachdenklich zog sie die Grußkarte ihrer Tochter aus der Tasche und betrachtete erneut Melindas Handschrift, die verspielten, frei fliegenden Schnörkel, die so wunderbar ihre Reife widerspiegelten. Wieder fixierte sie das Ausrufungszeichen und das Wort „Mama“ davor, und wie immer wendete sie die Karte dann, um den kitschig bunten Weihnachtsbaum zu sehen.
Zauber des Loslassens!
Melindas 22. Geburtstag stand an. Entspannt atmete sie aus, verschloss ihre Augen vor dem Vergangenen und floh aus ihrer schützenden Entfremdung. Es drängte sie, diesen Gedanken vor ihrer eigenen Doktrin zu schützen. Unruhig erforschten ihre Beine den Spielraum unter der Bank. Dann stand sie entschlossen auf und folgte der zarten kindlichen Leuchtspur, die durch den Wald geschlagen war. Und nicht einmal der stämmige, ungepflegte Mann, der ihr nun breitspurig begegnete, konnte ihr gezähmtes Gedankenkarussell zum alten Kreisen zwingen. Sein aufgedunsenes, bärtiges Gesicht, sein dicht behaarter Körper, der in einem schwarzen, goldbedruckten T-Shirt steckte und selbst die penetrante Spur, die sein süßes Rasierwasser durch die Waldluft zog, alle Widerwärtigkeiten dieser Welt blieben unbedeutende Randerscheinungen auf ihrem Flug zurück in die Freiheit. –
– Seine Bank war tatsächlich leer. Vielleicht ein leiser Wink, sich für den Rest dieses schnulzig schönen Tages dem Optimismus hinzugeben. Entzückt ließ er seinen schweren, breiten Körper auf die Holzbalken nieder sacken, um sich in sein gedankliches Lieblingskabinett zurückzuziehen, in den Reinraum der Seelenastronomie.
Jeder Mensch war ein Sonnensystem, in dem die Erden ihre Bahnen zogen. Die Jugend formte aus dem Staub des Unbewussten die Sonne des Ichs, und sobald deren Strahlkraft gefestigt war, umkreisten sie geschäftige Planeten; Bedürfnisse, Verpflichtungen, Lasten und Lüste zogen dann im Bannkreis des Zentralgestirns umher, alles lief in festen Bahnen, unentrinnbar, unbeeinflussbar, bis das kleine Systemchen unter leisem Ächzen und Wehklagen wieder im Unendlichen zerstaubte.
Ha! Es war die pure Ironie, dass eben diese triste Unabänderlichkeit sich gar so geduldig formen ließ. Die Kunst war und blieb das einzig Bewegende in dieser öden, beliebigen Welt. Sie spielte mit all den plumpen Charakteren, die doch nur lebten, um gespielt zu werden. Und das Volk jauchzte und johlte artig, wenn es sich selbst in den Geschöpfen erkannte, wenn Mars und Venus aufeinander krachten und die emotionale Erschütterung, die das dramatische Energiegefälle vorübergehend mit sich brachte, letztlich im glücklichen Finale wonnige Erstarrung fand.
Noch einmal kam ihm die verknöcherte, überschminkte Frauengestalt in den Sinn, der er soeben begegnet war. Zweifellos – das war Walpurga, die verirrte Mutter aus seiner noch unvollendeten Erzählung. Bestimmt, du altes Scheusal, dachte er ihr nach, hat deine Halsstarrigkeit schon jeder satt, aber obgleich dir alle Welt entgegen lebt, wähnst du dich doch im Recht – ein Universum der Bitternis und Einsamkeit, dessen Ende allerdings ebenso ungewiss verbleibt wie das Schicksal der Welt. Endlose Ausdehnung oder Zusammenbruch in sich selbst?
Die Entscheidung des Dichters stand an.
Hatten Walpurgas Augen nicht ein wenig hoffnungsfroh geschimmert – ganz so, wie es dieser schaurig klischeehafte Sommertag eben erzwang? War da nicht ein kleiner Komet auf ihrem Steingesicht verglüht, eine kindliche Leuchtspur gezogen?
Die Inspiration drängte ihn. Ein Flug in die Freiheit! Er würde die Mutter überleben, erkennen, vergeben lassen, würde ein rosenumranktes Ende schöpfen und der etablierten Literaturgesellschaft moralisierend einen Tritt verpassen. Walpurga würde zur Widerstandskämpferin gegen Links und Mitte, die Muttergöttin der freiheitlichen Weltherrschaft, die Speerspitze seiner neuen Schaffensperiode, die erst Verwirrung stiften, zuletzt aber mit dem alten Applaus enden würde. –
„Darf ich die Uhr haben?“ Der kleine Bengel mit den lehmbespritzten Stiefeln hatte sich offenbar soeben materialisiert und deutete respektlos auf das linke Handgelenk seines gewichtigen Gegenübers. „Du hast ja an der anderen Hand noch eine!“ begründete er seinen bescheidenen Wunsch.
Der Dichter blickte dem jungen Mars, der irgendeinem Kindergarten entkommen sein musste und offenbar unbeaufsichtigt das Gefüge der Welt gefährdete, drohend in die Augen. Der grimmige Vernichtungsblick seines mächtigen Bartkopfes hatte schon manchen Mut gebrochen. Er näherte sich dem kecken Gesichtchen auf wenige Zentimeter, aber die bewährte Drohgebärde glitt durch die fragenden Augen des Jungen nicht nur ins Leere, sie verschob dessen Mundwinkel sogar noch weiter nach oben.
Das war nicht die Zeit für einen mühelosen Sieg. Nach kurzer Überlegung nickte er, zog das verzichtbare Stück aus seiner umfangreichen Sammlung mit einem Ruck vom Handgelenk und wies den kleinen Bärentöter an, gut darauf Acht zu geben. Der aber war mit einem hellen Freudenschrei bereits im Wald verschwunden.
Das war auch nicht die Zeit, hier noch weiter rumzusitzen! Eine beinah verglühte Sonne kollidiert mit einem mächtigen jungen Universum, alles wird neu, das Leben ist ein Geschenk und im Schenken liegt das Leben! So lautete die Botschaft der Muse. –
– Das Leben ist ein Geschenk!
Gerade eben musste der Gedanke reif geworden sein, so klar war die Absicht, so folgerichtig und gewiss. Entschlossen hob sie ihren Kopf von seiner Schulter und suchte die vertrauten blauen Augen. „Richard …“ Sie nannte nur seinen Namen und führte ihren Blick zurück hinaus, um im Glanz des Sees noch Kraft zu schöpfen und endlich ihren Herzenswunsch zu formulieren. „Wir sollten unsere Liebe weiter schenken“, flüsterte sie ihm dann zu, und leiser noch: „Ich möchte Mutter werden. Und du würdest gewiss der beste Vater sein!“
Unruhig suchten ihre Augen Einverständnis, während ihn der heiße Atem ihrer Herzlichkeit umklammerte.
Noch einmal durchstürmte sie indessen die vergangene Nacht, ihren Dienst im Krankenhaus. Wieder sah sie das für tot erklärte Kind mit seinen langen, blonden Engelslocken. Es atmete, sein Herz schlug jung und stark, das Blut musste munter durch die Adern schießen. Gewiss war lediglich, dass das Gehirn des Mädchens keinen Strom mehr zeigte. Nur noch Minuten trennten das Kind von dem finalen Eingriff, für den es gepflegt und ernährt worden war. Nach der Narkose würde man an ihm zu schaffen beginnen, um ein anderes, unbekanntes Menschenleben zu verlängern. Der Kopf des Engelchens würde bedeckt werden und mit ihm das Wunder eines allzu kurzen Lebens, das sich an diesem warmen, bleichen Körperchen wohl nur deshalb so auffallend zeigte, weil eine empfindungszarte Seele im Aufschrei der Anmut Schutz und Beistand suchte.
Schon die Tage der Pflege hatten sie diesem Geschöpf verpflichtet. Und als die Kleine nun ein Händchen hob, zaghaft, kraftlos, um das Dunkel dieser Welt von sich zu weisen, just als sie ihr Bett in den OP-Saal schob, da setzte sie ein kühnes Zeichen: „Das machen wir jetzt nicht“, hatte sie den Ärzten zugerufen, selbst erstaunt von der Festigkeit in ihrer Stimme, und das Mädchen kurz entschlossen wieder fortgeschoben. Es hatte Aufruhr gegeben, aber letztlich hatte sie niemand deshalb gerügt.
Sie fühlte sich stark, erwachsen, geborgen in der Liebe ihres Mannes und bereit für alle und alle Aufgaben der Mutterschaft. Richard würde sie nicht enttäuschen. –
Er hatte ihren Worten Gelegenheit gegeben nachzuklingen. Denn hätte seine Frau den Gedanken nicht geäußert, so hätte er es getan, eben heute, eben hier, hier auf dieser Bank am See, wo sie ihm einst ihr Ja gegeben hatte.
Ja, er wollte seine Lebenszeit verschenken, wollte einen lieben Gast willkommen heißen und bedingungslos willkommen heißen, was dessen Weg auch mit sich brachte. „Natürlich werde ich der beste sein“, versprach er mit dem stolzen Lächeln eines jungen Vaters, und Hand in Hand beendeten sie die kurze Rast, flogen weiter über Stock und Stein und überließen die alte Schicksalsbank der heißen Sonne des Nachmittags. –
– Als habe der Gedanke des Zeitschenkens einen Wall gegen die Welt errichtet, stand die Bank am See nun leer, bis ihr der Schatten des Waldes Kühle spendete und ein Rollstuhl leise knarrend, vom Knirschen wuchtiger Schritte begleitet, neben dem alten Holz zum Stehen kam.
„Es ist nicht schön!“ Die zarte, weißhaarige Frau schüttelte bekräftigend den Kopf. Ihre Stimme raunzte in auffälligem Kontrast zu ihren gütigen Augen. „Es ist wirklich nicht schön, nur noch Last zu sein!“
Der untersetzte Mann, der ihren Rollstuhl geschoben hatte, rang um Atem, aber er nützte diese Not, um den Wehklang seiner Stimme zu betonen: „Niemand ist glücklich, Mama, wenn du dich zurückziehst! Leo kann sich kaum daran erinnern, wie du aussiehst!“
„Und das ist gut so!“, schnaubte sie, während sie nach allen Seiten Ausschau hielt und ihre Mundwinkel so zweideutig spielen ließ, dass niemand hätte sagen können, ob ein Abgrund hinter ihren Zügen lauerte oder doch ein alter Schelm.
Der schwergewichtige Sohn hockte sich nun ächzend vor den Rollstuhl und erklärte im Hochdruck des nahen Blickkontaktes feierlich: „Ich freue mich wirklich, dass du gekommen bist, um Leo wieder zu sehen!“
Sie sah wortlos über ihn hinweg und ließ ihren Oberkörper nach links und rechts schwanken, als würde sie angestrengt irgendwo im Wald etwas entdecken wollen.
„Meinst du denn nicht auch, dass Leo öfter eine Oma haben sollte?“ Er wollte noch nicht lockerlassen und schmückte seine Frage mit dem treuherzigsten Lächeln, aber die Alte blieb in ihrer Festung und lugte nun strafend daraus hervor: „Kinder brauchen ihresgleichen“, fuhr sie ihn an, „keine Auslaufmodelle wie mich, die nicht einmal mehr laufen können. Ich bereue schon, dass ich mich zu diesem Unsinn habe überreden lassen!“
Sich selbst zu schwer geworden, richtete er sich stöhnend auf. Indes sah sich die Alte unruhig um. „Sollte der Bengel nicht hier auf uns warten?“ fragte sie, herzlich um Strenge in der Stimme bemüht. Aber noch ehe der Sohn die Unternehmungslust des Enkels rechtfertigen konnte, stand der Junge mit den lehmbespritzten Stiefeln wie aus dem Boden geschossen da, spähte kurz nach seinem Vater und danach, verschämt nur aus den Augenwinkeln, auf die beglückte Frau im Rollstuhl, gewährte aber beiden keine Zeit zum Lamentieren. Wichtig war, was er aus seinen Hosentaschen kramte.
„Ich habe eine komisch eingehüllte Frau getroffen!“ Seine helle Stimme überschlug sich fast. „Sie hat aufgezeichnet, wie ihr Bruder aussieht, seht mal!“ Schon hielt er seiner Oma den zerknüllten Zettel vors Gesicht, den er sich erbettelt hatte. Schon zog er noch etwas hervor und überstürzte sich in seinen Schilderungen, was sich alles zugetragen hatte. „Ich habe einem kleinen Mädchen geholfen, seine Mutter zu finden, und ein dicker Mann hat mir diese Uhr geschenkt!“ Schon wies er auf das viel zu große Silberding, das von seinem Händchen gleiten wollte, aber eigentlich suchte er ja etwas anderes. Zuletzt gelang es ihm, das widerspenstige Ding heraus zu ziehen, das Wichtigste, sein Geschenk.
Er trat dicht an den Rollstuhl, seine Blicke verschmolzen mit dem Sonnenlicht, bestrahlten die Oma, und er drückte ihr eine Kassette in die Hand. „Die Musik ist für dich!“, sagte er, „ich habe sie von einer alten Frau bekommen. Sie hat gemeint, dass sie dir bestimmt gefallen wird!“
„Mir?“, rief die Großmutter überrascht, und in ihrer Frage spielte nun endlich wieder die alte, samtfarbene Stimme, die sich so gut zu ihrem Wesen fügte. Ihr Sohn ließ sich verblüfft neben ihr nieder, während Leo die allgemeine Sprachlosigkeit munter für sich nutzte. „Ja“, berichtete er, „ich soll die Musik mit meiner Oma anhören, hat die Frau gesagt. Wahrscheinlich hat sie gewusst, dass Papa immer anderes zu tun hat. Hast du für mich Zeit?“
Die Augen des Kleinen leuchteten.
Zeit schenken!
Sie genoss die wunderbare Wärme dieses beglückenden Gedankens. „Natürlich habe ich Zeit für dich“, antwortete sie, „aber nun erzählst du mir mal ganz genau, wie das alles zugegangen ist, in Ordnung?“
Leo blickte sie vergnügt an und dann hinüber zu seinem bass erstaunten Vater, dessen rastlose Augen einmal ihn, dann wieder seine Oma suchten.
„Komm zu mir her!“, rief sie lächelnd und schickte sich an, den Jungen zu umarmen, um ihm einen zarten Kuss auf seine Stirn zu drücken.
Er ließ es geduldig über sich ergehen; die seltsamen Eigenheiten der Erwachsenen schreckten ihn nicht mehr. –
– Irgendwann, als alles berichtet und für gut befunden war, kletterte Leo auf die Bank und genoss inmitten seiner Familie die zittrigen Spiegelbilder, die der sanfte Wind und die satte Nachmittagssonne in das Wasser zauberten. Die breiten, schweren Schatten der umliegenden Berge badeten bereits im See. Und unbemerkt, im Sog der Frühlingsgedankenflüge, landete ein wenig Blütenstaub auf den schmutzigen Stiefelchen, die von der Bank hinab zur Erde baumelten.

Grafik: Hans Beletz