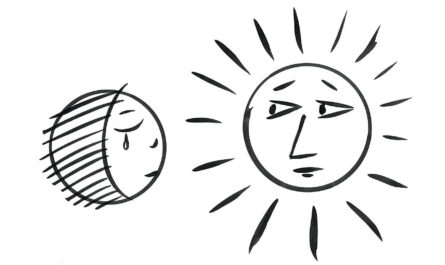November | Melancholie und Abschied
• Leuchtend weißer Nebel stieg aus der herbstlichen Abenddämmerung empor. Rio Quente, der warme Fluss, quoll aus fernen Höhen herab, zischend stürzte er die Kuppen und Klippen entlang, verlor an der mächtigen Felswand seine Form und gewann sie wieder als smaragdgrüner See. Meterhoch wolkte die Wärme über ihm, durchflutet vom Rot der gewaltigen Sonne, die dunkel flimmernde Regenbögen in das tiefgrüne Land zauberte.
Staunend suchte der Mann den Ursprung des endlosen Wasserfalls, doch jener war kaum zu erahnen. Zaghaft trat er näher. Keinen Gedanken verschwendete er länger an die Frage, wie er hierher gelangt war. Gebannt schaute er nur und sah, und wo immer sein Blick sich verfing, erstanden neue Wunder, als ob sein eigenes Auge dies rauschende Leben erzeugte.
Dicht vor seinen Füßen schlug der See in seichten Wellen an das Ufer. Bald drängte es ihn, den Quell an sich zu spüren, in ihn einzutauchen, die ganze lange Reise wegzuwaschen. Und ohne Rücksicht auf seine Erschöpfung, seine Krankheit, sein Alter, ohne die Kleider abzulegen oder an das Danach zu denken, ergab er sich, ganz Kind, der Sehnsucht des Augenblicks.
Umspülte wirklich Wasser seinen Körper? Das Warm hatte kaum Substanz, in seiner Leichtigkeit mutete es an wie geronnener Wind, und doch veränderte es ihn mit ungeahnter, unbändiger Kraft. Es löschte ihm die Erinnerung an jede Mühsal; alle starren Krusten, die ihn geschmerzt und bekümmert hatten, fielen perlend ab, sogar seinen Namen schienen die Wolken sanft mit sich hinfort zu tragen.
Nach dem Bad atmete er das Glück vollkommener Freiheit, wunschloser Zufriedenheit. Nun erst wurde ihm bewusst, wie viele Menschen das Ufer des Rio Quente säumten, und mit jugendlicher Neugier trat er ihnen näher.
Sie waren von erhabener Schönheit, edlem Wuchs und stillem Stolz. Er erkannte die herbe indianische Natur in ihren Zügen, die er auf seinen Reisen oft bewundert hatte. Eine ferne Ahnung trieb ihn einem der Lederhäutigen näher. – Zwinkerte der Krieger ihm tatsächlich zu oder zuckte nur unwillkürlich seine Wimper? Schon drängte es ihn, diesen seltsam vertrauten, doch Achtung gebietenden Fremden anzusprechen, als etwas in der Ferne seinen Blick bannte.
Ein Eindruck, ein Gedanke, eine lebenslange Sehnsucht.
Aufgewühlt wandte er sich wieder dem Indianer zu, fragend, Zustimmung erhoffend, zugleich aber nahm ihn das Bild in der Ferne gefangen, und nur halb anwesend bemerkte er, wie der Krieger ihn dazu ermunterte, endlich seinem Glück nun zu begegnen.
Er hatte schon gefürchtet, einem allzu wundervollen Trugbild erlegen zu sein, jählings im Moment der größten Freude doch aus einem Wunschtraum gerissen zu werden. Aber auch als er ihr schnell und schneller zueilte, wich Jana nicht von der Stelle.
Unmittelbar war ihm wieder gegenwärtig, was diese Frau ihn hatte empfinden lassen. Nur einmal hatte er das Ideal einer vollendeten Gestalt wirklich erblickt, eine Stimme vernommen, deren Wohlklang ihn mit jedem Laut durchtönte; nur einmal hatte er ein weibliches Wesen erlebt, das mit jedem Blick, jeder kleinsten Geste neue Sehnsucht entfachte.
Warum hatte er Jana nie umarmt, sie gepackt und sich selbst mit ihr fortgerissen in ein gemeinsames Leben?
Unendlich lang erschien es ihm, seit er sie zuletzt gesehen, aber die Menschen, Moden und Machwerke von Generationen hatten der Innigkeit, die ihn von je mit ihr verband, nichts anhaben können.
Sie streckte ihm nun wortlos, leuchtenden Auges, die Arme entgegen, er empfing ihre Freude und Liebe, und sanft, sanft drückte er sie an sich. Ein flüchtiger Gedanke an eheliche Treue durchbrannte ihn noch einmal, aber nur vage und fern nagte der Schmerz des Verzichts. Was das Leben gefordert hatte, war erfüllt; er war frei, wie Jana, und bereit.
Tränen glänzten in beider Augen, wieder und wieder suchten ihre Blicke einander, um jetzt, da endlich alles gut wurde, feierlich ein bedingungsloses Ja zu geloben, und für einen kurzen Moment, dessen Aufflackern sie heftig mitempfand, wollte er sie leidenschaftlich küssen. Dann aber floss die Liebe in so mächtigem Strom, dass sie beide in heiterer Scham über diesen bedeutungslosen Gedanken lachen mussten. Und als sie einander in die Augen sahen und das Leben erspürten, gerann dieser Moment zur Ewigkeit. –
Da standen sie am Ufer des Rio Quente. Es war Nacht geworden, eine prickelnd klare Kühle hatte das Land erfasst. Den hellen Dampf über dem smaragdgrünen Wasser durchschwebten dichte weiße Flocken. Immer wenn eine auf der Haut aufleuchtend ihre Form verlor, geriet sein Körper in sanftes Vibrieren. Fühlen! Ein Weltgeheimnis lag in dieser Fähigkeit, heilend und beruhigend durchgeistete ihn die zärtlichste Berührung. Nur Schnee! Wie wäre die Nähe eines Menschen je auszuspüren!
Beide tauchten sie lachend in das Nass, und ein Rausch der Lebendigkeit durchflutete sie, vereinte sie und führte ihre Gedanken ineinander.
Am Wasser schwebend, schauten sie die Flocken durch die dünnen Nebelschwaden herabtänzeln, direkt aus dem Nichts kamen sie, und unweit strahlten die Gestirne mit ihren zahllosen Trabanten. Jeden von ihnen hätte er greifen können, um ihn ganz nah an sich zu ziehen, alle Geheimnisse des Lebens waren plötzlich offenbar.
„Das All wächst wie ein mächtiger Baum“, sagte er, „er verästelt sich, es entwickelt sich und bringt leuchtende Früchte hervor. Und wir Menschen kosten und kosten ganz besessen vom Baum des Lebens.“
„Die Welt ist ein Lebkuchenhaus“, stimmte Jana lachend zu. „Wir betreten sie, bis wir uns an ihr satt gegessen haben!“
Er blickte noch tiefer in den Himmel. „Der Stamm ist dunkel“, sagte er, „aber die Früchte zeigen sich. Alles, was wir leuchten sehen, sind Früchte des Baumes!“
Später, als ihre Blicke die Sterne wieder entließen, wussten sie beide, dass diese milde Winternacht die Bahnen ihres Schicksals vereint hatte. Die Vergangenheit zerfloss im Raum der Hingabe, die Zukunft leuchtete aus überirdischer Ferne. Noch nie zuvor hatte er bewusst in der Ewigkeit gelebt, aber das gleißende Licht, das schon einmal sein Herz durchfahren hatte, streifte ihn erneut und ließ ihn endlich ein Sein ohne Grenzen erfahren, ohne Zeitbeschränkung, ein Werden ohne Vergehen, Leben ohne Tod.
Als die mächtige Sonne wieder heraufdämmerte, um einen neuen Frühlingsmorgen einzuleuchten, war er mit Jana schon unterwegs, um den mächtigsten der Gletscher zu erwandern, deren lichtumspielte Gipfel sich zur Mittagszeit im Rio Quente spiegelten. Sie waren über märchenhafte Felder aus übergroßen, bunten Trollblumen gewandert, hatten die üppigen Farne und Moose am Fuß des Mount Robson durchquert, das vielfarbig grün leuchtende Baumland und die breit mäandernden Moore unter sich gelassen, und nun, in großer Höhe, genoss er den weichkörnigen Firn unter den bloßen Füßen. Seine Zehen wühlten sich in die angenehme Kühle, und Schritt um Schritt flogen sie beide höher, bis sie vom Gipfel aus das weite, jenseitige Tal erschauen konnten, das Jana ihm so dringend hatte zeigen wollen.
Doch der Blick hinab bedrückte das Gemüt. Fern lag es, unwirklich erschien es in seiner dunklen Tiefe, durchwoben von einem zähen, grauen Dunst, der allen Farben ihre Leuchtkraft und den Konturen ihre Schärfe raubte. Träge krochen die Menschen darunter hin, besonders die Ältesten, Hilfebedürftigsten vegetierten kläglich.
Gern hätte er diesen Schleier an einem Ende gepackt, ihn hochgerissen und hinaus ins Nichts geschleudert, um dem Leben dort unten seinen Frohsinn zurückzugeben, aber er wusste wohl, dass er dafür zu schwach war.
Jana belachte seine vorauseilenden Gedanken in glühender Herzlichkeit.
„Vielleicht können wir hingehen und einen Faden herausziehen“, schlug sie vor, „einen dünnen nur. Damit sollten wir beginnen!“
„Morgen! Gleich morgen!“, nickte er zustimmend.
Abends, am herbstlichen Lagerfeuer, fragte er: „Wo sind wir hier? Im Paradies?“ Sie antwortete: „Erst im Vorgarten, denke ich!“
Wie inhaltsreich und lebenslang dieser eine Tag in der Erinnerung erschien! So viele Eindrücke suchten noch Gestalt; in die Bilder des Heute mischte sich das ferne Gestern, Schicksalsspuren fanden zueinander, und ein alte, ewige Weisheit, von der er nicht wusste, ob sie in ihm oder um ihn war, ermaß mit Einsicht jede Wende auf dem Pfad des Seins.
Gern hätte er sich der neuen Winternacht ganz hingegeben und weiterhin erspürt, wie zarte Lebensprägungen sich zu Sinn und Ziel vereinen. Selig hätte er die Nacht durchwachen mögen, doch unversehens fühlte er eine übermächtige Ohnmacht. Ein schwerer Raum aus Zeit und Endlichkeit umhüllte ihn.
Immer noch perlte aus Janas Lachen das große Leben des Rio Quente, doch ihr Quell erreichte ihn nicht mehr.
Ein eherner Abschiedszwang durchatmete plötzlich seine Welt, entrückte alle Worte und Gefühle; Wunsch und Wille verkümmerten.
Warum? schrie sein Herz, und wie ein Echo jagte ihm eine letzte Empfindung hinterher, Janas heiße Sehnsucht. Ihr liebevoller Nachruf ereilte ihn noch, bevor er dahin gerissen wurde, und im Hinübergehen wusste er sich mit ihr vereint. –
Nachdem er sich eingefunden hatte, wollte er seine müden Augen öffnen, doch kaltes Licht trieb ihn zurück ins Dunkel.
„Herr Kübler!“ Eine geschäftige Frauenstimme rief, er vernahm sie nur von fern. Hatte der Rio Quente ihn doch nicht mit sich fortgetragen und aufgelöst, diesen abgelebten Namen, dem sich die Mühsal und Einsamkeit des Greisenalters verbanden, Jahre des erstarrten Erinnerns und Sich-hin-Schleppens?
Er wollte nicht antworten, wollte sich von dieser schweren, alten Welt nicht wieder fangen lassen.
„Herr Kübler! Können Sie mich verstehen?“ Kläglich mühte sich die Stimme, sein Bewusstsein zu erreichen. Hier in Janas Nähe erschien es ihm fast lächerlich, wie sehr sie sich darum mühte.
Nicht in dieser trüben Welt erwachen!
Aber konnte er sich diesem Leben schon in Trotz verschließen?
Als seine Augen dem kalten Licht vorsichtig Einlass gaben, lächelte ihm die Gestalt der Stimme zu, eine Krankenschwester – und er, der Kranke, lag erschöpft im Bett und musterte die Frau in der weißen Anstaltsuniform – brünett, grünäugig, vollschlank.
„Herr Kübler“, tröstete sie ihn, „es ist alles in Ordnung, Sie haben es geschafft. Können Sie mich sehen? Können Sie mich hören?“
Er wollte antworten, doch sein Mund war allzu trocken, so nickt er nur stumm.
In scheuer Langsamkeit blickte er sich nun im Zimmer um und schloss bald wieder seine Augen, als jemand energisch die Tür aufschlug und jäh alle Aufmerksamkeit an sich riss. Die volltönende Stimme eines Nachrichtensprechers trat ein.
„Ah, Herr Kübler! Es freut mich, Sie wieder unter den Lebenden zu wissen!“, rief der Arzt. Seiner routinierten Begrüßung folgte ein Stakkato mit den Neuigkeiten: Herzinfarkt … ein Passant, der zum Glück schnell reagierte … fünf Minuten lang klinischer Tod … trotzdem erfolgreiche Wiederbelebung … wohl einen aufmerksamen Schutzengel gehabt …
Ohne Anteilnahme ließ er die Schilderungen über sich ergehen.
„Ruhen Sie sich aus, Herr Kübler“, mahnte ihn der Arzt sodann. „Sie brauchen noch Erholung, und Sie werden gut betreut. Haben Sie Angehörige, die wir benachrichtigen sollten?“
Hatte er Angehörige? Er war in diesen kurzen 92 Lebensjahren so lang allein gewesen!
Schon vor 15 Jahren war seine Frau verstorben – und auch in diesem kinderlosen Lebensbund hatte er an ihrer Seite Einsamkeit erfahren; ihr Tod hatte ihm keine tiefe Wunde schlagen können.
Angehörige? Aufmerksame Zeugen seines Lebens? Das Suchlicht der Erinnerung streifte die Mutter, den Vater, ein paar Kumpel aus der Jugendzeit, die seinen Lebensweg begleitet hatten. Aber sie alle waren tot, und neue Freunde hatte er keine mehr gefunden, vielleicht auch nicht finden mögen. Lieber hatte er sich fremden Ländern und Kulturen verbunden; sein spärliches Kontaktbedürfnis war durch solche Reisen ohne weiteres befriedigt worden.
Er schüttelte den Kopf. Nein, keine Angehörigen!
Der Arzt und die Schwester nickten beide freundlich, und während er das Zimmer grußlos schon wieder verließ, fragte sie: „Ist die Wohnadresse, die wir in Ihrem Ausweis gefunden haben, ein Betreuungsheim, Herr Kübler?“
Man sah es ihm wohl allzu deutlich an – dieses dumpfe, schlaffe Dasein zwischen Mahlzeit und Mahlzeit, die zermürbenden Kartenspiele mit dementen Damen, die jede Wendung mit den immer gleichen Worten und dem immer gleichen Stöhnen kommentierten, dieses überbehütete Leben, in dem jeder Toilette-Besuch als Abenteuer zählte.
Er nickte widerwillig. Ja, seit langem schon konnte er sich nicht mehr selbst versorgen! Tag für Tag raubte ihm das Greisenalter Stück um Stück von seiner Freiheit. Er, der sich die Welt so gern erforscht hatte – Brasilien, Afrika, immer wieder Kanada! –, war jetzt zu langsamem Hinsiechen verurteilt. Und als er sich endlich aufgerafft hatte, um unter Schmerzen seinem Gefängnis zu entkommen und hinaus, hinaus ins Leben zu eilen, war er nicht weiter gelangt als bis zu diesem tristen Bett.
Oder war er es am Ende doch?
Da lösten sich die hadernden Gedanken, die über die Jahre an ihm festgewachsen waren.
Erneut durchschauerte ihn der belebende Odem des Rio Quente. Er war der Heimat immer noch verbunden.
„Wen sollen wir benachrichtigen?“, fragte die Schwester.
Er gab ihr den Namen eines Pflegers und hätte ihr auch einen beliebigen anderen nennen können. Sie alle, die die Abgesonderten und zu leicht Gewichteten routiniert der Kälte der Welt entretten, hatten seine Achtung. Doch er selbst war nun frei von ihnen, unabhängig wie in seinen besten Jahren.
„Ich sehe bald wieder nach Ihnen!“, versprach die Schwester freundlich, empfahl ihm Ruhe und überließ ihn eilends seinen Gedanken.
Johanna! Sie hätte Johanna benachrichtigen können, dachte er der Krankenschwester nach, als ihn die Empfindung zurück in seine Jugend trug, in die so unbekümmerten wie schicksalsschweren Jahre, in denen das Leben formbar ist, die Zukunft weit und offen scheint und niemand dieses kurze Glück zu schätzen weiß.
Johanna hatte er geliebt, wie man das anmutigste Mädchen der Welt nur lieben kann, mit der arglosesten Ergebenheit des Unerfahrenen.
Im Gymnasium hatten sie zwei wunderbare Jahre an der selben Schulbank verbracht, im Haus ihrer Eltern hatten sie gemeinsam gelernt und einander dabei – die süßeste Erfahrung seiner jungen Jahre! – heimlich mit Zärtlichkeit beschenkt.
Rundum hatte diese traute Zweisamkeit andeutungsvolles Gemunkel erregt, denn man vermutete Johanna einem anderen, älteren Jungen zugetan – Marco, einem auffälligen Einzelgänger mit langem, schwarzem Haar, lederner Haut und einem nervösen Augenzucken, das seiner drahtigen, indianisch anmutenden Gestalt etwas Unberechenbares, Aggressives gab.
Doch über diese Beziehung schwieg sie. Ihn hätte die Rolle des Konkurrenten auch überfordert. So aber genoss er die gemeinsamen Stunden mit Johanna so unbeschwert und heiter, wie er später nie mehr vom Leben kosten konnte. Ihre Zuneigung machte ihn träumen, und für immer gegenwärtig blieb ihm jenes nächtliche Gespräch über die Schwerelosigkeit der Liebe … endlos hatten sie damals philosophiert und die Geheimnisse des Daseins bis hin zum Tod ertastet. Nie hätte er vergessen können, wie sie sich nach durchwachter Nacht lachend durch das hohe Almengras bergab dem Morgenrot entgegenrollten – vereint in jener tiefen Seelenverwandtschaft, die ihm selbst alles bedeutet hatte, während sie bei Johanna womöglich doch nur einen kleinen Reinraum der Gedanken ausgefüllt hatte. Denn über diesen kostbaren Momenten, in die er so gern sein Leben verwurzelt hätte, schien sie wie durch einen unlösbaren Zwang Marco in der Pflicht zu stehen. –
Bald nach dem Abitur, an einem kühlen Novemberabend, zerbrach die Jugendfreundschaft schließlich so mysteriös, wie sie sich entwickelt hatte.
Johanna erging sich in ihrer letzten gemeinsamen Stunde in einem seltsamen Monolog. Sie klang wie eine Frau, die ihre Jugendzeit aus weiter Ferne übersah und zu seiner nicht mehr passte. Allzu erwachsen geißelte sie ihre pubertäre Überschwänglichkeit, sezierte die eigene Unreife, entschuldigte sich gar für die Hoffnungen, die sie geschürt hatte. Er indes spürte vor allem das Unausgesprochene zwischen ihren Worten, empfand die Sehnsucht hinter dem widerspenstig-entschlossenen Mienenspiel, in welchem er die alte Freundin kaum noch kannte.
Zuletzt verabschiedete sie sich mit dem Hauch eines Kusses und versiegelte ihr Geheimnis mit den Worten: „Vielleicht wird später einmal alles gut!“
An jenem Novemberabend begann die melancholische Welt seiner Reifezeit sich zu verflüchtigen.
Bald erfuhr er, daß seine große Liebe nach Paraná ausgewandert war, um dort mit Marco auf der Fazenda seiner Eltern zu leben.
Wie wenig er doch von Johanna gewusst hatte!
Als die Post aus Brasilien auch nach der zweiten, dritten, vierten Grußkarte ausblieb, war der erste große Abschied seiner jungen Jahre vollzogen. Und als seine Gefühle später im Bund der Ehe erblühten, verblassten die Erinnerungen an Johanna … bis ein halbes Leben später ein magischer Augenblick des Wiedersehens die mächtigsten Empfindungen seiner Jugend unerwartet wieder aufrühren sollte.
Fast wären sie an diesem Morgen wie Fremde aneinander vorbeigehastet, aber ein Eindruck, ein Gedanke, eine Sehnsucht ließ ihn innehalten, sie rief behutsam seinen Namen, und ein unsichtbares Band führte beide wie mechanisch zueinander … Eine herzliche Umarmung, ein freundschaftlicher, zarter Kuss, und schon trieb der ferne Novemberabend zurück ins Jetzt. –
Lange hatten sie einander wortlos angestarrt und nur die Gedanken spielen lassen. Schließlich aber fragte er, die Jahre der Trennung heiter missachtend: „An welches Später dachtest du denn gestern?“ –
Er hatte ihr Lachen erhofft, eine vertraute Geste wenigstens, die ihm das achtzehnjährige Mädchen wiedergebar, einen Moment unbekümmerter Liebe hatte er genießen wollen, und sei es um den Preis des flüchtigen Verrats an seiner längst missglückten Ehe.
Johanna aber erwiderte nichts, nur ihr Blick blieb an ihn geheftet, seltsam hilflos und unbewegt – bis sie die Augen senkte, um eine Träne zu verbergen.
Nein, es war kein leerer, jugendlicher Überschwang gewesen, und sie hatte auch gewiss nicht nur mit seiner Unerfahrenheit gespielt. Ihre Zuneigung war echt und tief gewesen. Zu tief, als dass sie jetzt so einfach hätte ungezwungen lachen können. Stattdessen offenbarte sie ihm nun unvermittelt die Geschichte ihres Lebens – und die von Marco, dem indianischen Jungen, dem sie gefolgt war.
Er hatte ihren geheimnisvollen Entschluss, nach Brasilien zu gehen, bisher immer einer märchenhaften Liebe zugeschrieben, die spielend alle Grenzen überwinden konnte, der gegenüber seine eigenen Gefühle unbedeutend waren. Doch nun erfuhr er von dem Schicksal, das Johanna diesem Jungen so innig und tragisch verband.
Jenes große, selbstverantwortliche Leben, dem die Kindheit entgegendrängt und das die Jugend sich unter Zweifel und Schmerz erobert, war für Marco unerreichbar geblieben. Er hatte um seine Krankheit gewusst, die ihn durch erbarmungslos dem Horizont des letzten Abends entgegendrängte. Und als er sich Johanna anvertraut hatte, war es für sie ein Gebot des Gewissens, ihren Freund aus Kindheitstagen zu begleiten – in Gedanken, Gesprächen und in manchem kleinen Abenteuer.
Aber nichts ist gering, wenn jeder Augenblick am Leben haftet. Als Marco ihr dann seine Liebe gestand, im Ton einer Entschuldigung, verzweifelt, ihr doch keine Zukunft bieten zu können, kippte ihre Freundschaft in einen Abgrund: Sie war Halt und Stolz eines Menschen, den sie immer wie einen Bruder gemocht hatte, aber nun nicht einfach lieben konnte.
Und wie sehr litt sie unter ihren Gefühlen! War es nicht doch nur seine Krankheit, die ihre Hingabe untergrub und eine egoistische Sehnsucht nach einem erfüllteren Leben entfachte?
Als Marco zuletzt immer streitbarer sein Schicksal beklagte, wusste Johanna längst nicht mehr, was sie wirklich drängte. Sie verbat sich alle Regungen, die ihre Gefühle hinterfragten. Ihre Hilfsbereitschaft gefror zu trotzigem Pflichtbewusstsein, und sie harrte in ihrer Rolle der gütigen Freundin bis zur Selbstverleugnung aus.
Das nahe Glück indes verbannte sie an jenem Abend im November mit schalen, verkopften Worten aus ihrem Leben.
Als Marcos Familie sie in Brasilien mit offenen Herzen empfing, verschloss sie sich nur noch mehr, und der Hochzeit, dem letzten großen Wunsch, den sie zu erfüllen hatte, folgte bald die Beisetzung ihres jungen Mannes. Aber selbst am Grab empfand sie nichts, was ihr bewiesen hätte, dass doch ein Funken Liebe sie in diese Welt getrieben hatte.
Johannas Blick lag auf seinem Ehering, und sie sagte noch: „Ich bin nicht mehr das unbekümmerte Mädchen, das du kanntest!“
Er wusste ihr nichts zu erwidern. Was hätte er antworten, tun, ändern können? Nur seine Gedanken riefen hinaus, wie sehr er sie immer noch liebte, aber der treue Gatte versagte sich jedes Wort und wagte in diesem Moment der Offenbarung keinen Blick an die Geliebte. – Johanna beendete das vielsagende Schweigen, indem sie zärtlich seine Hände umschloss. Dann flüsterte sie wieder, diesmal fast unhörbar: „Vielleicht wird später einmal wirklich alles gut!“ –
Johanna …
Nein, Johanna hätte die Schwester gewiss nicht benachrichtigen können. –
Durch das Fenster des Krankenzimmers sah er den Tag in trübem Nebel liegen, aber sein fester Entschluss zauberte ein zufriedenes Lächeln auf das alte Abenteurerantlitz.
Er würde nicht mehr über eintönige Kartenspiele oder unbedeutende Routinen klagen. Morgen schon wollte er einen ersten dünnen Faden aus dem grauen Gewebe ziehen.
Die Schleier würden sich lichten.
Johanna würde dann vom lichtumfluteten Gipfel des Mount Robson hinab ins Tal sehen, und aus ihren Augen würde die stille Freude strahlen, die aus der Lebensnähe schöpft.

Grafik: Hans Beletz