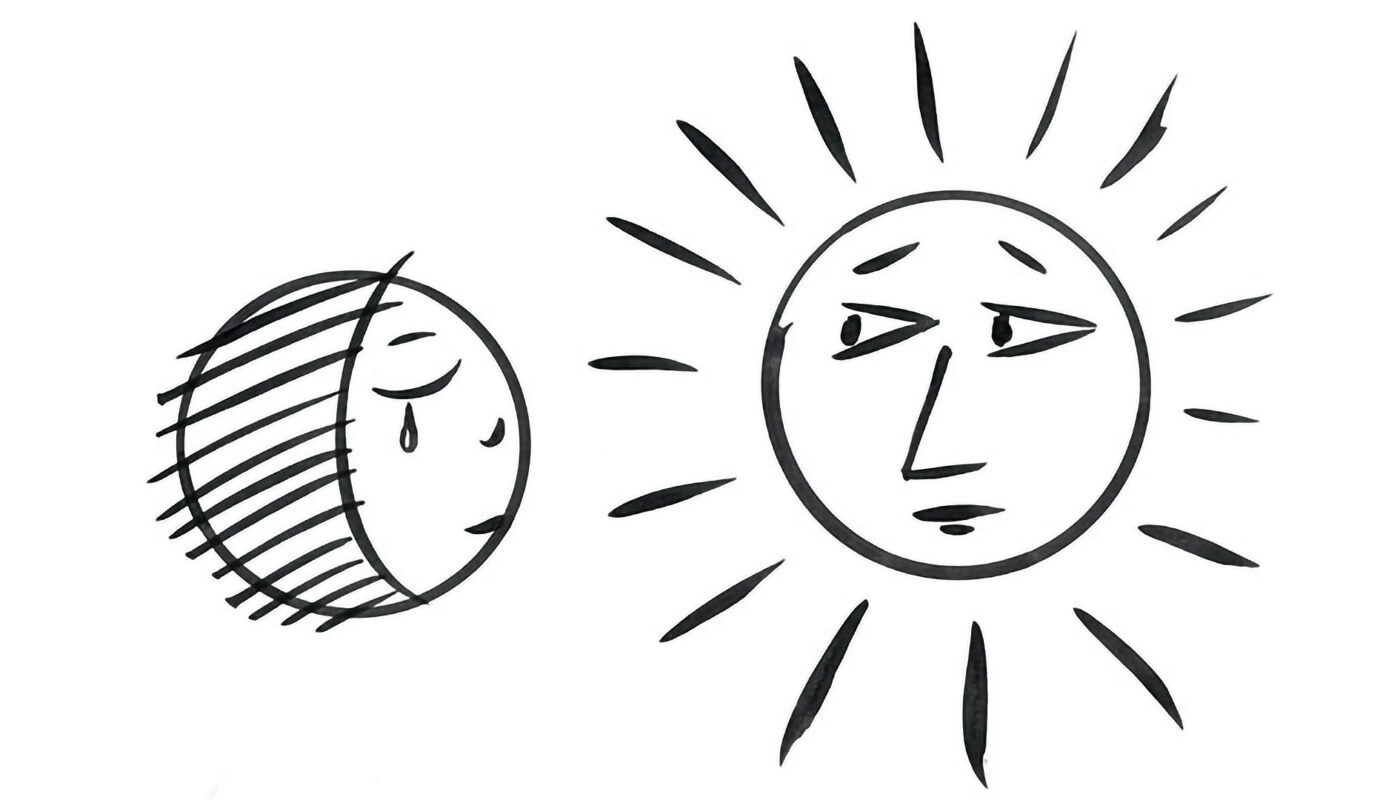Mein Freund Jens #4
• Die Wogen der jungen Erinnerung brandeten noch, sie netzten ihre hellbraunen Augen und durchbebten ihr zerbrechliches Wesen, bis ihr die Stimme versagte. Ich hatte Mühe gehabt, Julia zu folgen, denn viel mehr noch als das, was sie von ihrem Erleben am Sterbebett des Vaters zu erzählen wusste, hatte sie selbst meine Aufmerksamkeit gebannt. Machtlos lächelnd rang sie nun um Worte, und mir schien in diesem stillen Augenblick, dass die Jahrzehnte, in denen ich Julia nicht gesehen hatte, auf geheimnisvolle Weise aus meinem Leben gelöscht worden waren. Ich war wieder der schüchterne, verliebte Junge im Gymnasium, der es nie und nimmer gewagt hätte, diesem Himmelswesen näherzutreten, der es nach Kräften vermied, in der Nähe dieser Lebensglut peinlich hilflos zu erröten.
Julia! Durch sie hatte ich während eines Klassentreffens im Jugendcamp vor mehr als 30 Jahren meinen Freund Jens kennengelernt. Wir hatten damals, Brüder in unserer spätpubertären Sehnsucht nach Wahrheit und Erkenntnis, nächtelang über Gott und die Welt philosophiert – er, der extrovertierte, schlagfertige, aber herzensgute Kumpel aus dem Norden Deutschlands; ich, der eher zum Grübeln neigende Wolfi aus dem österreichischen Salzkammergut – und, in der längsten aller Nächte im Camp, auch einmal Julia, die lebensfrohe Schönheit, die auf verschlungenen Pfaden irgendwie mit Jens verwandt ist und ihn damals zu unserem Klassentreffen wohl deshalb eingeladen hatte, weil er gerade zu Besuch bei ihr gewesen war.
Danach aber hatten uns die Fliehkräfte des Lebens wieder auseinandergetrieben – bis ich Jens vor kurzem zufällig begegnet war und seither unser beider Bedürfnis, den alten großen Fragen neu zu begegnen, immer wieder eruptiv zum Durchbruch kam. Allerdings lugte aus ihm mittlerweile der spitzfindige Zyniker hervor; in seiner atheistischen Gesinnung hatte Jens sich zum blühenden Kaktus entwickelt, der seine Stacheln gern in Glaubensdogmen bohrt, während sich in mir der eher unzeitgemäße Glaube verfestigt hatte, die Wunder des Lebens und Erlebendürfens seien gewiss einem höheren Bewusstsein zuzuschreiben. Ein energetisches Spannungsfeld, das die herrlichsten Freundschaftsfehden garantierte!
Aber nun saßen wir hier mit Julia am Tisch, und das alte Mädchen erzählte vom Tod ihres geliebten Vaters. Sie erzählte es Jens, der von der Zäsur im Leben seiner Kameradin wohl schon erfahren hatte, und erzählte es vor allem mir, als gäbe es mein halbes Leben nicht, als würden uns von je die trautesten Bande der Freundschaft umschlingen.
„Entschuldigt bitte“, flüsterte sie nun in die Stille hinein und lächelte tapfer, „aber es ist mir alles noch zu nah …“
Mein stummes Nicken blieb ein schwacher Versuch, auch Jens rührte sich nicht.
„Ich bin meinem Vater immer verbunden gewesen“, sagte Julia leise, „aber einen Menschen so zu spüren wie in diesen letzten Stunden … den Menschen selbst, versteht ihr? … das war … eine Erfahrung!“
Julia erzählte von dem Augenblick des letzten Ausatmens und Loslassens, bei dem sie förmlich mitgerissen worden war, um dort, in jenem Raum, fern seiner lebensleeren Hülle, ihrem Vater nochmals nah zu sein.
Jens trübte mit keinem Zwischenruf die andachtsvolle Stimmung, die ihre Erzählung gebot. Es schien, als habe der Funke des Wissens, der in Julia glühte, ihre Erfahrung, dass das Leben im Sterben tatsächlich nicht endet, den Zyniker und Skeptiker gehörig irritiert. Ich indes war sprachlos, wie diese Frau, die ich einst aus Schwärmerei bewundert hatte, mir nun aus der Seele sprach, als seien wir darin verwandt, und das nicht nur mit Worten, die ich selbst nicht hätte finden können, sondern mit der Zaubermacht der Selbstverständlichkeit, wie sie einzig dem Erleben innewohnt.
Aber schließlich, es war nicht anders zu erwarten, blies Jens dann doch zum Rückzug hinter die Demarkationslinie, die das Hoheitsgebiet des Verstandes vom Feuerland der Empfindung trennt.
„Wolfgang hat mir kürzlich angeraten, den Unterschied zwischen Bewusstsein und Tagbewusstsein zu suchen“, sagte er, „und außerdem meint unser geschätzter Freund hier, dass wir mit unserem freien Willen zwar bewusst Entscheidungen treffen, die uns aber zunächst trotzdem unbewusst verbleiben.“ Er blickte mich konzentriert an. „Habe ich das einigermaßen korrekt wiedergegeben?“
Ich nickte – eher unbewusst und unfreiwillig. Dass Jens ein altgedienter Meister darin war, ohne Umweg auf den Punkt zu kommen, überraschte mich nicht mehr. Jedoch fand ich seinen Einstieg ins Gespräch nun doch recht rücksichtslos, wie einen allzu lauten Werbeblock, der sich im Fernsehen ohne Atempause an den letzten Seufzer einer Filmromanze schließt.
Julia aber hatte wohl gerade durch die Nüchternheit seiner Bemerkung aus ihren Erinnerungswogen gefunden und schien dankbar für die Einladung in das lebensferne, aber gut geschützte Reich der Theorie.
„Ich weiß zwar nicht genau, worüber ihr gerade diskutiert“, sagte sie, „aber eines steht doch außer Zweifel: Was wir im Alltag erleben und als wichtig erachten, was an Notwendigkeiten und Sachzwängen unseren Verstand bewegt, ist nur ein matter Abglanz des eigentlichen Lebens.“
Und dann brachte Julia ein eindrucksvolles Gleichnis, von dem sie sagte, dass es ihr vor kurzem aufgegangen war. Sie verglich unser Ich, den bewussten menschlichen Wesenskern und seine Willenskraft, mit dem Sonnenlicht, das alles belebt, und unser Alltagsbewusstsein mit dem Schein des Mondes, der nicht aus sich selbst leuchten, sondern nur das Licht der Sonne reflektieren kann.
Nach einem so stimmigen Gleichnis hatte ich hoffnungsfroher Idealist immer gesucht, um mir das Zusammenspiel zu verdeutlichen zwischen dem eigentlichen, geistigen Bewusstsein, das meines Erachtens nach dem Tod weiter bestehen musste, und dem gehirnverbundenen Tagbewusstsein, das mit dem Körper vergeht: Wie die Sonne in unserem Sonnensystem, so ist das geistige Bewusstsein das stets strahlende, lebensspendende Zentrum unseres Menschseins! Und wie der Mond nur in der Nacht und mit Hilfe der Sonne seine Pracht entfaltet, so zeigt sich auch in der umnachteten Wirklichkeit, die wir als Alltag erleben, lediglich ein Abglanz unseres eigentlichen Bewusstseins. Wenn man jedoch in diesem Widerhall des Lichtes nach eigenständiger Leuchtkraft sucht – wie die Gehirnforschung von Verstandesfunktionen auf den freien Willen schließen will –, so lässt sich naturgemäß nichts finden …
Ich war begeistert von dem Sinnbild. Jens jedoch hatte Mühe damit, weil er Gleichnissen generell verständnislos begegnete. Ich versuchte ihm zu verdeutlichen, dass man das kausale, horizontal-lineare Ursache-Wirkung-Denken ganz gut durch eine vertikale Art von Logik nach dem Muster „wie oben, so unten“ ergänzen könne, aber auch dieser Gedanke erschien ihm als Sinnbild der Unsachlichkeit.
So entschlossen wir uns – auf Anraten Julias –, unsere freundschaftliche Weltanschauungsfehde für diesen Nachmittag zu beenden und uns statt dessen der gemeinsamen Erarbeitung des Abendessens zu widmen.
Bald standen wir also zu dritt in der kleinen Küche und bereiteten mit vereinten Kräften ein Sushi-Festmahl vor – mein Freund Jens als vorzüglicher Reiskoch, ich, der wahrscheinlich unbegabteste Nori-Wickler der Welt, und Julia, die beachtliche gestalterische Kreativität bewies.
Es blieb nicht aus, dass ich sie zum Abschluss dieses Abends – noch ganz erfüllt von der zentrierenden Yang-Kraft der Speise und ohne die geringste Schwärmerei – mit meinem Geständnis konfrontierte, sie faszinierend zu finden. Für einen Moment überlegte ich sogar, ihr zu offenbaren, früher, im Gymnasium, bis über beide Ohren in sie verliebt gewesen zu sein. Und vermutlich hätte sie darauf geantwortet, weise und lebenserfahren: „Ja, ich weiß, aber mit uns wäre das nichts geworden. Du warst zu unerfahren und naiv – und ich habe zu früh zu viel erlebt.“
Damit hätte sie wohl Recht gehabt.
Aber das wäre eine ganz andere Geschichte.
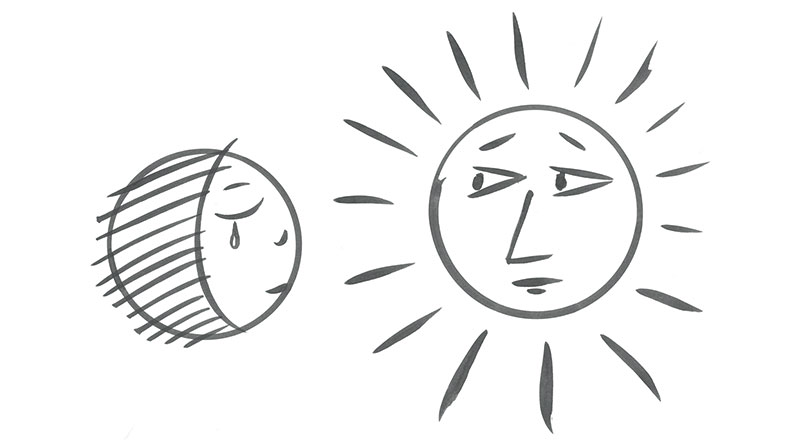
Grafik: Roger Gut