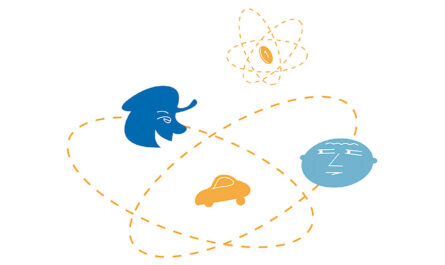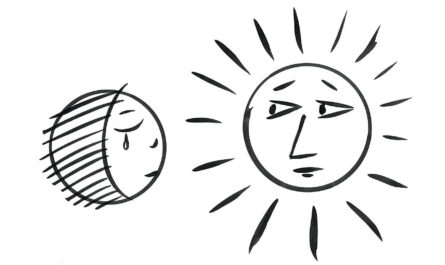Mein Freund Jens #6
• Jens lächelte verschmitzt. Uns war wieder einmal Julia durch den Kopf gegangen. „Das führt uns jetzt zu dem Thema schlechthin!“
Ich überlegte, während meine Zunge abermals den kräftigen niederösterreichischen Blauburger umspielte, den wir gewählt hatten. Welches Thema meinte er? Schicksal? Die Macht der Vorsehung?
„Frauen“, sagte Jens. „Dieses Thema ist doch wirklich Männersache, meinst du nicht auch?“
„Wo liegt das Problem?“, wollte ich wissen.
Er füllte sein Glas abermals mit dem tiefdunklen Rot, für das wir uns entschieden hatten. Das würzige Holunder-Aroma des kräftigen Tröpfchens bewährte sich bestens als Gesprächsbegleiter.
„Das Problem liegt in der Praxis“, antwortete Jens, wein- und redselig, machte aber sofort klar, dass es ihm doch mehr ums Theoretische ging. Um das Weib als solches.
„Du weißt, ich mag … nein, ich liebe Frauen!“, begann er mit Überschwang in der Stimme. „Ich habe sogar Verständnis für den guten alten Goethe, wenn er sagt, dass uns das Ewig-Weibliche hinan … hinan zieht … wohin auch immer. Und ich sage dir, ich habe – ich habe – schon mal eine Frau erlebt, die Sehnsuchte geweckt hat und mich … Himmel stürmen ließ, Himmel, verstehst du, du altösterreichischer Idealist?“
Jens stockte, starrte sekundenlang in sein beinahe leeres Glas und raffte sich dann auf, um mit wehmütigem Tonfall fortzufahren „… aber der graue Alltag … Wenn mich die Frau hinan zieht … wohin auch immer … und ich hinterhertrotteln soll, dann gibt es ein Problem. Ich glaube, unser seliger Loriot hatte Recht: Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen!“
Ich schmunzelte. Der Sketch mit dem Frühstücksei kam mir in den Sinn. „Ist mir auch schon durch den Kopf gegangen“, gab ich zu.
„Und?“, fragte Jens.
Ich zuckte mit den Schultern und leerte mein Glas. „Ich weiß nicht, ob es ein Patentrezept für das Zusammenleben gibt. Ich kenne keines.“
„Aber deine idealistischen Ideen würden mich doch interessieren, lieber … Wolfgang … Johann von Goethe“, beharrte Jens, „du bist für alles Himmlische zuständig und musst mich jetzt aufklären … so von Mann zu Mann …“ Während der letzten Worte hatte er sich so weit zu mir herüber gebeugt, dass es mir unter anderen Umständen wohl als Bedrohung erschienen wäre.
Ich versuchte trotz aller Weinverbundenheit Ordnung in meine Gedanken zu bringen, wusste aber nicht, ob daraus noch etwas werden kann: „Naja, ich denke, dass in jedem Mann doch irgendwie der alte Jäger durchschimmert. Was immer er tut, er visiert sein Ziel an, irgendwo in der Ferne!“ – „Klar“, sagte Jens, der mir promillemäßig voraus war, „deshalb sehen wir den Buttertopf im Kühlschrank nicht. Der liegt viel zu nahe! Alte Weisheit. Richtige Weisheit.“
„Und wahrscheinlich hocken wir auch deshalb hier und philosophieren“, meinte ich. „Das ausschweifende Planen … theoretische und spielerische Gedankenkonstrukte, die möglichst viel vom ganzen Revier umfassen, die überordnen, verallgemeinern, die Zielrichtung vorgeben … das mögen wir, nicht wahr?“
„Ja“, bekräftigte Jens. „das mögen wir. Aber Frauen mögen das gar nicht.“ Er schüttelte seinen Kopf noch sekundenlang.
„Ich glaube, Frauen reagieren einfach auf das, was das Leben bringt“, befand ich. „Sie mögen die konkrete Praxis und orientieren sich lieber an ihrer Empfindung als an generalisierenden Planspielen.“
„Hmm“, brummte Jens. Dann dämmerte ihm eine Erkenntnis. „Das würde, biologisch bedründet, bedeuten, dass Frauen doch einen General brauchen. Wir Männer müssen die Richtung vorgeben! Stimmt’s?“
„Ich würde das lieber nicht verallgemeinern.“
„Na hör mal, um solche Erkenntnisse geht es doch die ganze Zeit in unseren philosophischen Erwägungen. Einfach, klar und allumfassend – so und nicht anders muss die Wahrheit sein!“ Jens versuchte aufzubrausen, ergab sich dann aber doch der Nachdenklichkeit: „Werd‘ mir jetzt nur nicht übertrieben … weiblich!“
„Die Geschichte zeigt jedenfalls, dass es meist Männer waren, die neue philosophische oder gesellschaftliche Konzepte entwickelt haben … oder auch religiöse Dogmen. Aber diese Ziel- und Konzeptfixierung ging nur zu oft über Leichen. Sie führte zu Kriegen, Glaubenskämpfen und Wahnsinnstaten. Und warum? Weil sie das Naheliegende übersah, den Menschen.“
Jens fixierte abwechselnd sein Weinglas und wieder mich. „Werd‘ mir jetzt nur nicht übertrieben weiblich!“, wiederholte er. So stolz ich darauf gewesen war, gerade noch ein paar brauchbare Gedanken formuliert zu haben, so sehr bezweifelte ich nun, dass wir in brauchbarer Verfassung waren, „das Thema schlechthin“ sinnvoll zu vertiefen.
Mein Freund wirkte abwesend. Aber er schenkte mir und sich selbst nochmals Wein ein und sah mir dann streng in die Augen. „Alles klar. Wir brauchen das Weibliche, um friedlich zu sein“, fasste er zusammen. „Nur … das Problem ist die Praxis.“ Wieder beugte er sich weit zu mir her: „Mann und Frau … weißt du, es kann da ernste Revierkämpfe geben. Und wer Jäger ist, lässt sich nicht so einfach vertreiben … oder vom Stier zum Ochsen machen. Zum Wohl!“
Ich stieß ein letztes Mal mit ihm an. „Weißt du was? Wir sollten für die Praxis optimistisch sein. Erstens um der Liebe willen – aber das wäre eine andere Geschichte – und zweitens, weil uns, wie Loriot es so treffsicher formuliert hat, bei genauer Prüfung klar wird, „dass erst die Frau jene kultivierte Atmosphäre schafft, gegen die es Spaß macht, aufzumucken.“
Zum Wohl!
Aus Loriots „Damenrede“ beim Bülowschen Familientag am 14. September 1974:
„Worauf beruht unsere gesellschaftliche Abhängigkeit von der Frau als solcher? Sind wir dem Kindesalter noch nicht entwachsen? Vermissen wir Mutters wärmende Oberweite? Tauschten wir vergeblich Schnuller gegen Zigarre? Müssen wir noch mit Puppen spielen?
Ach, was rede ich da von Abhängigkeit! Sind wir nicht frei in unserer männlichen Welt?
Vergegenwärtigen wir uns den Herrenabend, dieses launige Beisammensein im Kreise des eigenen vertrauten Geschlechts. Da wird nicht sinnlos durcheinandergeschwatzt, sondern durch das Erzählen stets derselben bewährten Geschichten ein kraftvolles Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt, und nach der gemeinsamen zügellosen Einnahme von Speisen und Getränken – Quittung bitte mit Stempel! – löst sich der oberste Knopf von Hemd und Beinkleid wie von selbst, und dann ist Freiheit kein leeres Wort mehr.
Frauen! Ha! Omo, Spüli, Weißer Riese, pflegeleicht: Wenn man Fernsehen, Funk und Illustrierten Glauben schenken darf – und es spricht ja nichts dagegen!? – sind das die Lebensinhalte unserer lockigen Gefährtinnen.
Der Traum vom Bacchanal entweicht lenorgepflegt.
Unsere Damen sind maßvoll und bescheiden, wahren im Genuss die Grenzen kulinarischer Schicklichkeit und bleiben in der Kleidung korrekt. Es sei denn, dass eine verwegene Cousine sich unter dem Tisch ihres ebenso elegant wie knapp gewählten Schuhwerks entledigt. Ein Einzelfall. Im großen Ganzen hemmten die Damen in den letzten tausend Jahren, so meine ich, den vitalen Schwung unserer männlichen Namensträger. Schon vor tausend Jahren hatte die Hausfrau immer was dagegen, wenn es galt, in Unschuld, voller Lebenslust, die Burg des Nachbarn brandzuschatzen, Bären zu jagen, solange die Kühltruhe noch voll ist oder auf der Heimfahrt vom Sängerfest auf der Wartburg noch 140 Sachen aus dem alten Opel rauszukitzeln.
Was ist es also, das uns dennoch stetig die Nähe unserer Damen suchen lässt?
Nun, ich fürchte, schon unser Stammvater, Ritter Gottfried, wußte insgeheim, dass gerade im Verbot, in der moralischen Behinderung durch weibliche Vernunft, die stärksten Reizmomente liegen.
Und wer ist unser Publikum? In wessen Augen mischen sich Furcht und Stolz beim Anblick unseres mittelmeergebräunten Muskelspiels? Wer sieht staunend zu, wenn es uns trotz spärlich werdenden Pfauenfederwuchses hin und wieder gelingt, ein Rad zu schlagen?
Jawohl, es ist das Weib!
Lasst uns resumieren: Nur bei voreiliger Betrachtungsweise erscheint uns rätselhaft, dass wir von dem nicht lassen können, was uns hindert, in maskuliner Natürlichkeit jauzende Höhenflüge anzutreten. Denn bei genauer Prüfung wird uns klar, dass erst die Frau jene kultivierte Atmosphäre schafft, gegen die es Spaß macht, aufzumucken.
So lasst uns das Glas erheben, vorübergehend den bacchantisch geöffneten obersten Knopf des Beinkleides schließen und unseren Damen für eine Unzahl historischer Verdienste danken.
Sie leben hoch, hoch, hoch!
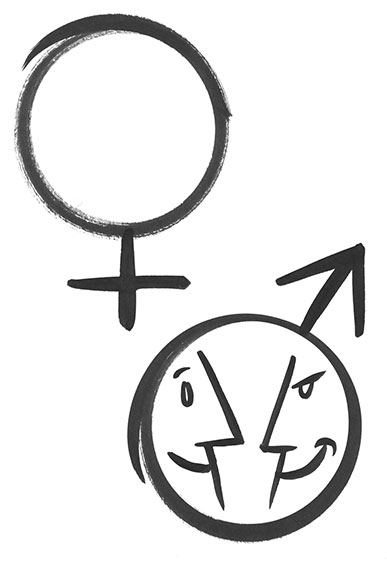
Grafik: Roger Gut