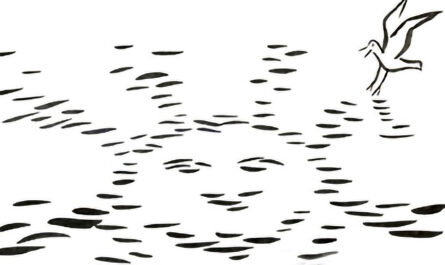September | Herbstwind und Blätterfall
• I.
Lokalredakteur Robert Liegner vom „Unabhängigen Volksblatt“ präsentierte am 10. September 1999 einen Leckerbissen aus seinem allzeit sensationsgebärenden Chronik-Ressort. Unter der launigen Schlagzeile „Panik im Affensaal“ schrieb er:
„Dieser Abend wird nicht so schnell in Vergessenheit geraten: Gabriel Gotthelf (48), ein bekannter Lebensberater, erlitt am Mittwoch im Affensaal bei seinem Vortrag ,Angstfrei auf dem Weg des Wassers‘ eine Panikattacke: Einer der Anwesenden, ein etwa 40-jähriger Mann mit schwarzem Vollbart, der offenbar von der Kompetenz des Vortragenden nicht überzeugt war, unterbrach um etwa 20 Uhr die Veranstaltung, trat auf das Podium und bedrohte den Redner zunächst wortlos mit einer Schusswaffe, bis dieser zitternd zu Boden ging. Daraufhin demonstrierte der vermutlich türkischstämmige Mann dem verängstigten Publikum, dass seine Waffe ungeladen ist, entschuldigte sich höflich für den Zwischenfall und verließ den Affensaal.
Gabriel Gotthelf wird bis auf weiteres keine öffentlichen Vorträge mehr halten. Dennoch bagatellisierte er die Affäre gegenüber dem ,Volksblatt‘. Er wolle keine Anzeige erstatten und habe während des Vorfalls ,in Wirklichkeit keine Sekunde lang Angst gehabt‘. Der Lebensberater im Originalton: ,Ich täuschte lediglich einen Ohnmachtsanfall vor, um die Situation zu entspannen!“
Damit die Angelegenheit weiter verfolgt werden kann, sucht die Polizei nach Augenzeugen.“
Nachdem die Hintergründe des Vorfalls nie aufgeklärt wurden und sowohl Gabriel Gotthelf als auch der vermeintliche Attentäter nicht mehr unter uns weilen, habe ich mich dazu entschlossen, die Angelegenheit posthum einer Enthüllung zuzuführen. Denn gewiss bin ich der einzige, der nicht nur den denkwürdigen Vortragsabend selbst miterlebte, sondern auch die involvierten Personen sehr gut kannte. Dass ich dies erst jetzt zugebe und mich den Ermittlern nicht zur Verfügung stellte, wird man mir nach diesem Bericht, wie ich hoffe, nachsehen. Auch kann ich besten Gewissens versichern, dass sich im Affensaal niemand in Gefahr befand.
Ich werde also zunächst einige Begebenheiten aus Gabriel Gotthelfs Leben schildern und in der Folge zwei bemerkenswerte Episoden aus meiner Freundschaft mit Martin Mühlbach, dem unbekannt gebliebenen Täter. Freilich sind diese Zeugnisse nicht als schönfärbender Nachruf geeignet. Vielmehr sollen hier tatsächliche Züge zweier Persönlichkeiten beleuchtet werden, an deren Zusammenprall im Affensaal ich, wie ich gestehe, nicht schuldlos war.
Das Ereignis selbst spielte sich tatsächlich etwa so ab, wie das „Volksblatt“ es berichtete. Allerdings gibt es keinen Zweifel daran, dass Gabriel Gotthelf absolut unterlegen war. Die auf ihn gerichtete Waffe entblößte ein hilfloses Nervenbündel; er verlor jegliche Kontrolle über sich, seine Knie brachen ein, seine Hände tasteten wie die eines Blinden nach sicherem Boden, und er starrte das Phantom seines Bedrohers noch fassungslos an, als der das Podium längst schon verlassen hatte.
Ich will nicht verhehlen, dass mich diese surreale Szene zunächst erheiterte, ja, aus einem Bann erlöste, ehe mich erst das Mitleid dazu trieb, dem verängstigten Mann wieder auf die Beine zu helfen.
Aber ich erzähle am besten der Reihe nach: Meine Bekanntschaft mit Gabriel Gotthelf reichte in die Jugendzeit zurück. Im Alter von 16 Jahren war ich ein eher introvertierter, gehemmter Junge und wurde auf diesen mir fremdartigen Menschen nur durch die Schwärmerei einiger Mädchen aufmerksam, die ihn in kritikloser Naivität anhimmelten.
Als ich eines Tages auf Drängen einer guten Freundin seine persönliche Bekanntschaft machte, überraschte mich zunächst vor allem, dass der Mann gut zehn Jahre älter als ich war. Zwar hatte ich einen charismatischen Draufgänger erwartet, aber meine Vorstellung ging doch dahin, jemandem in meinem Alter zu begegnen. So fand ich, obwohl er mich sogleich wie einen Freund umarmte, vorerst keinen arglosen Kontakt zu ihm; ich fühlte mich nicht herzlich aufgenommen, sondern unangenehm vereinnahmt und beobachtete seinen Dunstkreis mit ziemlichem Abstand. Er indes überbrückte mühelos die Generation, die ihn nicht nur von mir unterschied, sondern auch von der spätpubertären Mädchenhorde, die ihn umschwärmte.
Gabriel ließ sich damals übrigens noch „Joe“ nennen, der Erzengel in ihm war noch nicht erwacht, und zur cowboyhaften Kurzform seines Namens Johann passten der lange braune Schnauzbart, an dem er mit Vorliebe immer dann zwirbelte, strich und zog, wenn er plakativ lachte oder demonstrativ nachdachte, sowie der texanische Hut, mit dem er regelrecht verwachsen schien. Er war der Urtyp des verwegenen Abenteurers, der Leben in die städtische Öde bringt.
Beruf hatte er, soviel ich weiß, keinen erlernt. In einem Dienstverhältnis zu stehen oder eine gesellschaftstaugliche Selbständigkeit zu pflegen, in welchem Gewerbe auch immer, hätte seiner Vorstellung vom freien Leben widersprochen – jedenfalls vermute ich das im Rückblick. Damals, in seiner Gegenwart, hatte ich keinen Sinn für solche kleinbürgerlichen Gedanken.
Joe lebte als Künstler in einer fensterlosen Kellerwohnung, die er nicht nur für Mädchenbesuche, sondern auch als Atelier nützte. Er fotografierte und malte. Soweit ich mich erinnere, hatte er irgendwann bei einem bedeutenden Wettbewerb einen Preis gewonnen – jedenfalls stand er deshalb im Ruf, ein großer Künstler zu sein. Ob seine bunten Schaffensphasen, die er unter allseitiger Anteilnahme durchlebte, wirklich Großes zuwege brachten, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß noch, dass er eine Zeit lang – als bewusste Reduzierung der Lebensvielfalt – nur Kompositionen von Quadraten und Gurken auf die Leinwand brachte, was ich damals recht lustig fand, während es mir heute allzu gewollt und profan erscheint. Auch vermute ich, dass es abseits seines offiziellen Schaffens auch gewisse persönliche Experimente gab, denn in seinem Atelier hielten sich durchweg anregende Motive zur freien Verfügung.
Jedenfalls stärkten Joes künstlerische Arbeiten seinen Ruf als Freigeist ebenso wie sein Lebenskonzept, das vorsah, sich zwischenzeitig – „zum Erden“, wie er sagte – auf den alten Bauernhof seines alleinstehenden Vaters zurückzuziehen, auf die „Ranch“, wie er den Hof stilgerecht benannte. Was er dort in den Tagen und Wochen seiner Aufenthalte trieb, darüber weiß ich nichts zu erzählen, denn solange ich die Entwicklung des kleinen Anwesens beobachtete, konnte ich nur feststellen, dass es bedenklich verwilderte und in seiner Substanz verfiel, während die Berge von Unrat rundum wuchsen.
Joes Rückkehr von der Ranch in die Stadt erfolgte meist im Einklang mit einer neuen Bekanntschaft, wobei manche seiner formbaren jungen Begleiterinnen – wie lächerlich erscheint es mir heute! – ebenfalls Texashüte aufzusetzen begannen und damit ihre ergebene Zugehörigkeit zur Schau trugen. Aber immer flossen am Ende einer neuen Schaffensphase bittere Tränen, denn sein ausufernder Narzissmus bot keinen Spielraum für tragfähige Beziehungen; nie erfuhr er eine bodenständige, lebensnahe Frau als Korrektiv an seiner Seite.
Ich vermute, dass er sich dieses Lotterleben deshalb so lange leisten konnte, weil er, ganz das umsorgte Einzelkind, von seinen alten Vater vorbehaltlos jede Zuwendung erhielt. Jedenfalls vollzog sich nach dessen Tod – wie ich vermute, aus finanziellen Beweggründen – seine endgültige Metamorphose zur Kultfigur.
Aus Johann „Joe“ wurde Gabriel Gotthelf, aus dem Künstler der Künder. Sein Texashut hing nun an einem verrosteten Nagel auf der Ranch, der Bart war abrasiert, die Kopfbehaarung auf drei Millimeter gekürzt. Und passend zu der mönchischen Anmutung zeigte er sich fortan nur noch in Weiß gekleidet.
Ich war von dieser Wandlung damals beeindruckt und gebe gern zu, dass mir erst viele Jahre später der Abstand einer größeren Lebenserfahrung eine kritischere Sicht erlaubte. Nachdem meine anfängliche Skepsis verflogen war, lenkte mich in jungen Jahren die naiv begeisterte Überzeugung, in Gabriel Gotthelf habe sich ein Mensch in großartiger Weise selbst gefunden. Es zuzugeben, ist mir heute peinlich, aber wie viele andere in meinem Freundeskreis glaubte auch ich, dass er eine Art Erleuchtung erfahren haben müsse. Wir vermuteten ein ungewöhnliches Erweckungserlebnis als das Geheimnis seiner neuen Persönlichkeit, aber in vorauseilendem Gehorsam erachteten wir es als tabu, über diese intime, fast heilige Angelegenheit zu mutmaßen oder ihn darüber gar persönlich zu befragen. Blindgläubig und dumm, aber voller Eifer wurde ich also zum treuen Wegbereiter seiner Mission, die mit öffentlichen Vorträgen ihren Anfang nahm.
Ich zog von Säule zu Säule, von Laden zu Laden, von Möglichkeit zu Möglichkeit, Gabriel Gotthelfs stolz lachendes Konterfei möglichst flächendeckend zu affichieren.
Ein selbstbestimmtes Leben wider Angst und Abhängigkeit, Tod und Vergänglichkeit – solche Themen trafen damals den Nerv einer Zeit, die im gelebten Egoismus eine neue Therapie erkannte. Doch seine Vorträge dienten nur als Einstiegsdroge in eine phantastische Philosophie, die Gabriel den „Weg des Wassers“ nannte. Im Wesentlichen war seine Lehre – ich glaubte damals allen Ernstes, er habe sie aus sich selbst entwickelt – nichts weiter als eine eigenwillige Abwandlung des fernöstlichen Dualitätsprinzips von Yin und Yang. Sie wirkte daher in ihrer dehnbaren Logik durchaus schlüssig. Tatsächlich aber waren es wohl vor allem sein Charisma und eine bewundernswerte Sprachgewandtheit, die seine begeisterte Gemeinde wachsen ließen.
Zwischen ihm und mir kam es allerdings nach etwa drei Jahren zum Bruch.
Nicht, dass mich Gabriels veganisch orientierte Ernährungsvorschriften abgeschreckt hätten oder die immer teureren Fortbildungs- und Selbstfindungskurse, die seine Getreuen schon der Vorbildwirkung wegen besuchen mussten. Auch die dem Zen-Buddhismus entlehnten Meditationstechniken – etwa das reglose Verharren mit erhobenem Arm für wenigstens 30 Minuten – nahm ich allwöchentlich in Kauf, in der Verblendung, mich in dem Maß zu vervollkommnen, wie es mir gelingt, Schmerzen zu ertragen. Was indes den scharfen Kritiker in mir erzog, war eine rein persönliche Angelegenheit, bei der sich Gabriel dermaßen unverfroren zeigte, dass mich darüber – seinem tragischen Ableben zum Trotz – noch heute der Zorn packen könnte.
Ich hatte in der Tanzschule, die ich eigensinnigerweise trotz meiner Selbsterfahrungs-Scheuklappen besuchte, ein erfrischendes Mädchen kennen gelernt. Gudrun versprühte überschäumende Lebensfreude, war durch und durch Genießerin, kochte gern und pflegte in ihrer ungezwungenen Bodenständigkeit eine ausgeprägte Vorliebe für fleischreiche Hausmannskost. Kurz gesagt: sie war für das asketische, auf dem Element Wasser basierende Lebensmodell, das ich unter Gabriels Einfluss praktizierte, bis in die Tiefen ihres Leibes ungeeignet. Dennoch ersehnte ich ihre Liebe, die gerade erst zart zu erblühen versprach, und zugleich erhoffte ich ihr Wohlwollen für meine abwegige Weltanschauung zu gewinnen. Also kam mir die verwegene Idee, Gudrun mit Gabriel persönlich bekannt zu machen. Im Stillen wähnte ich, dieser außerordentliche Kontakt mit dem Quell meiner Lehre würde auch sie begeistern und einen ersten Schritt auf den Weg des Wassers führen.
In gewissem Sinn geschah dies tatsächlich – allerdings anders, als von mir geplant: Bald nach dem Erstkontakt, den ich ihm vermittelt hatte, lud Gabriel das Mädchen zu sich ein und genoss mit ihr in seinem alten Kelleratelier einen Abend ohne Askese.
Später erzählte mir Gudrun von dieser Affäre, ganz in ihrer unbeschwerten Art, denn meine eigenen Neigungen hatte ich ihr noch nicht gestanden. Sie beklagte den „ziemlich ausgeprägten Egoismus“ meines Freundes; er habe sie „einfach gepflückt“ und lasse sich seit dem gemeinsamen Abend „wie ein feiger Hund“ verleugnen …
Nachdem also der Weg des Wassers für mich allzu dünnflüssig geworden war und ich mehrere Wochen in düsterer Sprachlosigkeit vergrübelt hatte, stellte ich Gabriel Gotthelf mit dem Mut der Verzweiflung zur Rede. Immer noch erhoffte ich eine Erklärung, eine verständliche, seiner Lehre entsprechende Rechtfertigung, erwartete wenigstens eine Entschuldigung. Aber ohne mich anzusehen, stemmte er mir in geheuchelter Fürsorge die päpstliche Exkommunikation ins Herz: „Werner“, hauchte seine sonore Stimme, „ich fürchte, du bist für unsere Gruppe verloren!“ –
In den darauf folgenden Jahren mied ich Gabriel Gotthelfs Dunstkreis, und Sie werden nach diesen Schilderungen vielleicht auch meinen verhaltenen Zynismus entschuldigen. Ich kämpfte darum, mich von seiner krausen Lehre endlich restlos zu emanzipieren, die Dogmen auszuraffen, die mir tief ins Unbewusste hineinwurzelten, und die künstliche Begriffswelt zu überwinden, die den „Weg des Wassers“ so erfolgreich vor dem einfachen Leben getarnt hatte.
Heute wundere ich mich, dass die seltsamen Konstrukte dieses Menschen mich jemals gefangen nehmen konnten, und mich tröstet lediglich der – zugegeben wenig überzeugende und möglicherweise immer noch gabrielische – Gedanke, diese bitteren Erfahrungen wohl selbst benötigt zu haben. –
Erst Jahre später, im September 1999, stieß ich erneut auf Gabriel Gotthelf. Es warben immer noch die gleichen gelben Plakate mit schwarzem Aufdruck für seine Vorträge, aber das vertraute Porträt darauf war mir fremd geworden, sein Lachen erschien kalt und unpersönlich. Wohl aus dem Gefühl, dass eine ferne Zeit noch einen Abschluss sucht, entschloss ich mich, einem der angekündigten Vorträge beizuwohnen, allerdings ohne die Absicht, näheren Kontakt mit dem Meister meines frühen Lebens aufzunehmen.
Gabriel Gotthelf erschien, wie erwartet, in zeitlosem Weiß, aber sein Äußeres war mittlerweile von dem ewig-jungen Plakatfoto sichtlich überfordert, er wirkte alt und auch irgendwie verwahrlost. Ich konnte mich des Eindrucks nicht verschließen, der alte Joe würde wieder durch den Mönch lugen. Vor allem aber stellte ich mit Befriedigung fest, wie inhaltsleer mir seine Worte schienen. Ich sah nur einen bedauernswerten Mann, der andere mit seinem dumpfen Freiheitswahn umgarnt, während das ewige Strohfeuer, das sich wieder und wieder an der unbeschwerten Jugend entzünden will, seinen Urheber schon selbst versengt.
Was ich indes lieber vermieden hätte, geschah in der Vortragspause. Gabriel Gotthelf hatte mich erkannt, strömte auf mich zu, und noch bevor ich mich in meiner Verblüffung dagegen verwahren konnte, umarmte er mich in der gleichen vereinnahmenden Art, wie er es vor vielen Jahren bei unserem ersten Treffen getan hatte. Überschwänglich warf er mir ein kleines Kompliment zu: „Gut siehst du aus – immer noch so jung!“, schenkte seine Aufmerksamkeit dann aber, ohne eine Erwiderung abzuwarten, einem vielleicht sechzehnjährigen Mädchen, das mir schon aufgefallen war, als es seinen Texashut an der Garderobe abgegeben hatte. Und wie einem alten Freund, der seine Absichten ja kennt und gutheißt, zwinkerte er mir lachend zu, um mich damit meinen Gedanken zu überlassen.
Es war unglaublich! Binnen Sekunden hatte mich der Albtraum meiner Jugend wieder umfasst. Ich verkroch mich in die letzte Stuhlreihe, weil ich Haltung bewahren und nicht vorzeitig fliehen wollte. Aber ich konnte diese Begegnung nicht überwinden und nicht akzeptieren, dass das schaurige Spiel, das dieser Mensch mit meiner jugendlichen Leichtgläubigkeit getrieben hatte, nach so vielen Jahren einfach fortgeschrieben werden sollte. Während also Gabriel Gotthelf seinen Zuhörern weismachte, wie sie ihre Lebens- und Todesängste verlieren könnten, reifte mein Entschluss, den Mann bei nächster Gelegenheit einer Herausforderung zuzuführen.
Ich dachte bei meinen Plan an einen guten Freund, dessen ungestüme Spontaneität mein Leben würzte, seit ich ihn beim Wehrdienst kennen gelernt hatte: Martin Mühlbach. –
Damit Sie sich nun eine Vorstellung machen können, weshalb ich gerade ihn im Visier hatte, werde ich an dieser Stelle ein paar Begebenheiten schildern, mit denen mich dieser hochintelligente Mensch restlos verblüffte, wobei sich in mein Erstaunen – ich gestehe es unumwunden – oft ein Quäntchen Schadenfreude mischte.
Meine früheste Erinnerung an Martin führt uns zu einem Erlebnis während meiner ersten Tage als Grundwehrdiener: In seiner hochgewachsenen Gestalt stand er im Mannschaftsraum der Kaserne, und ihm gegenüber, noch ein wenig größer, ein äußerst kräftig gebauter Oberst mit Stiernacken und hochrotem Kopf, dem die aufbrausende Wut an den Schläfen die Adern dunkelrot hervor trieb. Oberst Schmitt war als brutaler Schleifer berüchtigt, verfügte auch stimmlich über tierische Aggressivität und donnerte Martin mit seinem Organ dermaßen an, dass man befürchten musste, der hagere Junge mit dem schütteren Haar könnte dem Schalldruck allein nicht Stand halten: „Wehrmann Mühlbach!“, plärrte er, „Sie sind der hinterfotzigste Idiot, der jemals in Uniform gesteckt hat. Ihre Wehrtauglichkeit muss ein tragischer Irrtum sein!“
Noch stand Martin reglos da, die Augen starr geradeaus gerichtet, nur seine Mundwinkel zuckten ein wenig. Oberst Schmitt setzte eine dramaturgische Pause, sog tief Luft durch seine Nüstern und schob den halslosen Oberkörper dabei so nah an den Jungen, dass die beiden Stirnen einander fast berührten. Er begann seinen Satz ganz leise, unheilvoll langsam, um die Stimme zwei Takte später orkanartig anschwellen zu lassen: „Aber ich schwöre Dir, mein Junge, dass Du unter Schmerzen lernen wirst, … dich bedingungslos unterzuordnen! Hast Du verstanden – Übelbach!?“
Niemand im Raum wagte jetzt noch hinzusehen, uns allen war der Atem gestockt. Nur aus den Augenwinkeln beobachtete ich vorsichtig, was geschah. Mit dem Antosen des Orkans begannen Martins Mundwinkel immer stärker zu vibrieren, sein Gesicht nahm grimassenhafte Züge an; es schien, als würde der Junge einen stummen Schrei bekämpfen, der ihm ausbrechen wollte, aber er sah dabei einem lächerlichen Kasper gleich. Oberst Schmitt durchbohrte ihn daraufhin mit einem noch stechenderen Blick, wie ich ihn vordem nicht für möglich gehalten hätte, und fügte seinem Ausbruch, nun wieder in getragenem Adagio und mit einem Anflug von mitleidigem Lächeln, hinzu: „Und jetzt, mein Söhnchen, darfst du reden. Du erzählst mir, was dich dazu veranlasst“ – erneut durchdonnerte es markerschütternd den Raum –, „mich so saublöd anzuglotzen!“
Nach einer kunstvoll gesetzten Pause antwortete Martin im Tonfall des Befehlsempfängers, aber im übrigen offenbar völlig unbeeindruckt: „Wenn ich erklären darf, Herr Oberst, es ist bei mir so: Wenn mir eine beeindruckende Persönlichkeit gegenübersteht, wie jetzt in Gestalt Ihrer Person, dann neige ich dazu, die eigene Fassung zu verlieren. Unwillkürlich nehme ich in solchen Situationen den Ausdruck meines Gegenübers an. Ich bitte darum, diese Eigenart von Wehrmann Mühlbach zu entschuldigen!“
Die Blicke des Obersts durchdrangen Martin für einige Sekunden, dann liftete Schmitt wortlos den Anker, nickte und verließ den Raum. Wir konnten nie herausfinden, inwieweit er dieses sagenhafte Schachmatt durchschaut hatte. –
Martin Mühlbach war nicht bloß mutig. Er verfügte, vielleicht als Nebenwirkung seiner außerordentlichen Intelligenz, über eine seltene, beinahe einzigartige Eigenschaft: Ohne auch nur ansatzweise bösartig, menschlich unangenehm oder schwierig im Charakter zu erscheinen, war er autoritären Ansprüchen gegenüber völlig immun, eiskalt. Ich denke, er sah alle Menschen irgendwie nackt, ohne sich im Geringsten von deren gesellschaftlichem Rang oder Auftreten beirren zu lassen. Die Rolle, die jemand spielte, empfand er einfach als nettes Kostüm für die Bühne des Lebens. Wenn ihn aber allzu selbstherrliche Darsteller herausforderten, erweckte das eine kreative und heißblütige Lust in ihm, andere zu entkleiden, was bisweilen zu unglaublich absurden Situationen führte.
Dass die so geborenen Realkomödien meinem Freund nie nennenswerte Vorstrafen eingebracht hatten, grenzt an das Wunderbare, denn auch Menschen in Polizeiuniform bewährten sich – ihrer autoritären Natur gemäß – für höchst gelungene Szenen.
So hatte Lokalredakteur Robert Liegner schon fünf Jahre vor der Panik im Affensaal die Gelegenheit, seinen Lesern im „Unabhängigen Volksblatt“ die Widergabe einer heiteren Verkehrskontrolle zu servieren, die im Tumult geendet hatte. Sein Bericht setzte Martin am 1. September 1994 unter dem Titel „Steifer Mann – was nun?“ ein publizistisches Denkmal. Zu lesen war damals folgendes:
„Dieser Vorfall dürfte Geschichte schreiben: Weil Martin M. (31) während einer Fahrzeugkontrolle in den Verdacht geraten war, ein bewaffneter Autodieb zu sein, wollte ihn die Polizei in Gewahrsam nehmen. Das jedoch erwies sich als überraschend schwierig, denn M. versteifte im Zuge der Festnahme seinen Körper, sodass alle Versuche, ihn abzutransportieren, erfolglos blieben. Erst ein Bus schuf Abhilfe. –
Zu der Anhaltung war es auf Grund überhöhter Geschwindigkeit im Bereich einer Baustelle gekommen. Weil M. mit dem Sportwagen eines Bekannten unterwegs gewesen war, aber dessen Zulassungsschein vergessen hatte, geriet er in den Verdacht, das Auto gestohlen zu haben. Nachdem er der Aufforderung auszusteigen, nicht sofort Folge leistete und die Beamten außerdem einen verdächtigen Pistolenkoffer im Wageninneren entdeckten, leiteten sie die Verhaftung ein. Damit begannen für die Exekutive allerdings – zur Belustigung des umstehenden Publikums – unerwartete Probleme, denn alle Bemühungen, den versteiften Verdächtigen in das Polizeiauto zu verfrachten, scheiterten. Nachdem sich auch die Rückbank des Fahrzeuges als zu kurz für den großen Mann erwiesen und eine lebhafte Diskussion im Kreis der Exekutivbeamten zum Schluss geführt hatte, dass ein Transport bei offener Hintertür entweder Kopf oder Füße der verhafteten Person gefährden würde, beides jedoch nicht zu verantworten sei, forderte man ein größeres Fahrzeug an.
Gegenüber dem ,Volksblatt‘ erklärte Martin M., der bald nach der Verhaftung wieder auf freiem Fuß war, die Versteifung sei ,eine reine Selbstschutzmaßnahme‘ gewesen: ,Die Beamten erschienen mir etwas rauflustig. Sie sollten später nicht behaupten können, sie hätten sich gegen mich verteidigen müssen und mich deshalb verletzt!‘
Der verdächtige Koffer stellte sich bei näherer Untersuchung als harmlos heraus.
Der Sicherheitsdirektion zufolge wird M. mit einer Verwarnung und einer geringen Geldstrafe wegen überhöhter Geschwindigkeit davon kommen.“
Sicher können Sie sich nun gut vorstellen, dass es keiner großen Überredungskunst bedurfte, meinen Freund für einen kleinen Krieg gegen den Mann zu gewinnen, der mir die Unmündigkeit meiner Jugend wieder übergestülpt hatte.
Martin war sofort für den Frontkampf bereit, umso mehr, als er abgepflockten weltanschaulichen Konzepten mit ausgeprägter Abscheu gegenüberstand. Kaum etwas lockte ihn so sehr zu Bloßstellungen wie allzu einfache Weisheiten aus den Universen von Religion und Esoterik.
Wie sich die kurze kriegerische Intervention gestaltete, wurde ja öffentlich bekannt, wobei ich anmerken muss, dass Martins Tarnung ein kleines maskenbildnerisches Meisterwerk war. Die Schwarzhaar-Perücke, ein stilgerecht aufgeklebter Vollbart und einige Retuschen ober- und unterhalb der Augen verwandelten ihn glaubhaft in einen türkischen Terroristen.
Als er nach seinem Auftritt den Affensaal zügig und ungehindert wieder verlassen hatte, war ich der erste, der Gabriel Gotthelf im allgemeinen Tumult wieder auf die Beine half. Zu diesem Sanitätsdienst drängte es mich, denn der Mann erschien mir im Moment seiner bitteren Niederlage nur noch bemitleidenswert.
Indem ich ihn stützte und er, schmachvoll geschlagen, seinen Blick von mir abwandte, zerbrach unsere Meister-Schüler-Beziehung.
Danach habe ich Gabriel Gotthelf nicht mehr gesehen. Vermutlich versuchte er bis zu seinem Ableben durch einen Autounfall bei strömendem Regen, für den „Weg des Wassers“ zu begeistern.
Robert Liegner widmete ihm im „Unabhängigen Volksblatt“ vom 8. September 2009 einen einspaltigen Nachruf.
II.
Damit endete mein Text, die Kreation einer Enthüllung, die vielleicht ein wenig in die Waghalsigkeit abgeglitten, indes wunderbar entlarvend gewesen war, und die ich vor allem als Ausdruck meiner Hochachtung gegenüber der wirklich herausragenden Persönlichkeit meines kürzlich verstorbenen Freundes betrachtete.
Ergänzt durch eine Grußkarte brachte ich die Arbeit zur Post, denn wenigstens einen Menschen gab es, mit dem ich meine Freude über das Gelingen unseres eigentlichen Lustspiels, das hinter diesen Zeilen stand, möglicherweise teilen konnte. Ich schrieb ihm:
Sehr geehrter Herr Doktor Moser!
Wie wir es besprochen hatten, sende ich Ihnen den Probedruck meiner soeben fertig gestellten humoristischen Erzählung.
Ich sehe unserem Rendezvous frohgemut entgegen und freue mich auf die Gelegenheit, Sie endlich persönlich näher kennen zu lernen. – –
Einige Tage später durfte ich Dr. Manfred Moser in der beeindruckenden Bibliothek seines Hauses besuchen. Ich hatte diesen stets elegant gekleideten, charismatischen Mann bis dahin nur flüchtig gekannt und von seinem Bruder lediglich erfahren, dass er als Kieferchirurg tätig ist und zwei ausgeprägte Leidenschaften pflegt, Psychologie und Literatur. Sein Urteil über meine Erzählung, die ich ihm brieflich vorab hatte zukommen lassen, war mir darum wertvoll, aber vor allem freute ich mich darauf, unsere bisher kaum gepflegte Bekanntschaft zu vertiefen.
Sofort ließ er mich wissen, dass er das Manuskript mit vorbehaltlosem Vergnügen gelesen habe, und nachdenklich fügte er hinzu: „Für unsere Familie wird dieser Text ein gültiger Nachruf bleiben, auch wenn Sie meinem Bruder einen anderen Namen verpasst haben.“ Dann spielte sofort wieder der Schelm auf seinem Gesicht. „Zum guten Glück erwähnten Sie seine schrecklich verwahrloste untere Zahnreihe nicht, für die er leider weithin bekannt war. Das hätte vielleicht doch eine zu deutliche Spur zu uns gelegt – und auf meine Arbeit kein gutes Licht geworfen. Ich durfte seine Zähne übrigens nicht behandeln, nur damit Sie das wissen!“
Der heitere Plauderton, in dem der hoch gewachsene Arzt mit mir sprach und die seinem tragisch verunglückten Bruder so ähnliche Stimme berührten mich in diesem Moment wie ein ferner Gruß meines Freundes und vertieften die traute Verbundenheit, die ich seit der Begrüßung auch ihm gegenüber empfand.
Etwas verlegen, als hätte er mir diesen Gemeinplatz lieber erspart, wollte Dr. Moser nun auch schon wissen, ob denn meine Erzählung durchweg autobiographisch sei. Sicher war ihm bewusst, dass diese Frage zu den einfältigsten gehört, die man einem Autor stellen kann, aber ich hatte sie in diesem Fall erwartet. Denn er wusste ja von der legendären Konfrontation in der Kaserne, und auch der polizeiliche Abtransport seines Bruders hatte im Kreis der Familie für Amüsement gesorgt. Indes musste ihm der Bezug zu Gabriel Gotthelf vollständig unbekannt sein, denn … diese Hauptszenerie meiner Enthüllungsgeschichte war in Wirklichkeit frei erfunden.
Also lüftete ich nun den Vorhang zu der Komödie hinter dieser Pseudo-Dokumentation. Ich zog eine alte Ausgabe des „Unabhängigen Volksblattes“ vom September 1994 aus meiner Tasche und wies auf den Beitrag, den ich zitiert hatte, mit dem Titel „Steifer Mann – was nun?“
„Sie erinnern sich?“, fragte ich meinen aufmerksam beobachtenden Gastgeber.
Dr. Moser schmunzelte. „Natürlich!“
„Dann wissen Sie sich vielleicht auch noch von dem Lapsus, der dem Redakteur dieses Blattes passierte, als er vom Abtransport Ihres Bruders Martin berichtete.“
Er nickte und zuckte lachend mit den Schultern. „Martin war der falsche Vorname. Solche Kleinigkeiten passieren wohl im Boulevardgeschäft. Und Sie haben aus ,Martin M.‘ Martin Mühlbach gemacht – eine beabsichtigte Anonymisierung, nehme ich an!“
„Ja“, bestätigte ich, „aber der entscheidende Unterschied zur Realität ist, dass ein Mensch namens Gabriel Gotthelf glücklicherweise nie gelebt hat. Diese Figur habe ich aus den Charaktereigenschaften besonders schrulliger Zeitgenossen meiner Jugendjahre modelliert!“
Dr. Mosers Auflachen glich einer Eruption: „Die Sache im Affensaal hat also gar nicht stattgefunden?“ fragte er, überrascht, aber auch ungläubig. „Ich meine doch, mich erinnern zu können, die Notiz, die Sie zitieren, selbst gelesen zu haben!“
„Es wurde auch wirklich darüber berichtet“, entgegnete ich seiner zunehmenden Irritation und zog ein Exemplar der Zeitung vom 10. September 1999 aus meiner Aktentasche. „Die ,Panik im Affensaal‘ ereignete sich im bunten Boulevard des ,Unabhängigen Volksblattes‘ tatsächlich, allerdings“ – ich schmunzelte ebenfalls, denn nun wurde es ernst – „nur dort!“
Endlich einen Geheimnisträger an seiner Seite zu wissen, war befreiend. Wenn er seinen Reiz entfalten soll, braucht Humor ein Umfeld. Ich berichtete Dr. Moser also von der blendenden, indes nie honorierten Schauspielleistung seines Bruders, über die wir beide absolutes Stillschweigen vereinbart hatten. Er hatte zwar nie den türkischen Terroristen gegeben, den ich in meiner Erzählung beschrieben hatte, aber er war – akustisch wenigstens – in die Rolle des Gabriel Gotthelf geschlüpft, meines fiktiven, weiß gewandeten Seelenfängers. In einem Telefoninterview von Robert Liegner hatte er überzeugend und ohne verdächtiges Grunzen in seiner künstlich nach oben geschraubten, nasal geführten Stimme bestätigt, am Abend zuvor tatsächlich mit einer Waffe bedroht worden zu sein. Und er hatte natürlich, im Sinne dieser Rolle, jeden Ausbruch von Angstschweiß während dieser Attacke strikt geleugnet.
Wie es bei einem Paradigmenwechsel solchen Ausmaßes üblich ist, benötige es ein wenig Zeit, ehe er im Bewusstsein angekommen war. Dr. Moser suchte noch nach Puzzleteilen für sein neues Weltbild. „Aber weshalb hatte Liegner mit meinem Bruder gesprochen“, fragte er, „über ein Ereignis, von dem doch niemand wissen konnte, weil es sich offenbar gar nicht ereignet hatte?“
Diesbezüglich konnte ich mich nun selbst als Antwort bieten, denn ich war es gewesen, der die fidele Phantasie des Lokalredakteurs auf die Spur dieser gewichtigen Zeitungsente geführt hatte. Ja, ich hatte Robert – exklusiv natürlich – von den Begebenheiten im Affensaal berichtet und ihm dann zur Vertiefung seiner Recherche die Telefonnummer überlassen, unter der Gabriel Gotthelf zu erreichen sei. Ein ehemaliger Redaktionskollege gilt schließlich als guter Informant!
„Sie waren Journalist?“, fragte Dr. Moser erstaunt.
Ich gab zu, dieser ambivalenten Zunft angehört zu haben, die richtend und berichtend alles Wohl und Wehe nachvollzieht. Ein wenig mutete dieses Geständnis an wie eine Beichte, aber ich hatte den kollektiven Schwachsinn, der die Redaktion des „Volksblattes“ andauernd benebelte, tatsächlich recht charmant gefunden, jahrelang sogar. Und der Gedanke an den süffisant schmunzelnden, ununterbrochen bedeutungsschwer an seiner billigen Filterzigarette saugenden Robert Liegner erheitert mich heute wie ehedem: Einmal täglich, pünktlich zur Redaktionskonferenz, tauchte er aus seinen Telefonrecherchen auf, um uns allen für die nächste Ausgabe die Krönung der aktuellen Sonderbarkeiten zu präsentieren. Er hatte dafür seine eigene Dramaturgie entwickelt, die in etwa der Aufmachung der Zeitung entsprach. Meist umriss er ein Ereignis zunächst nur in wenigen plakativen Stichworten und entwickelte erst dann die Szenerie, um die Skandale, Katastrophen und menschlichen Tragödien zuletzt schwelgerisch ihrer Pointe zuzutreiben; ein grinsender Meister des schwarzen Humors, den man hinter der konstruierten Sachlichkeit seiner publizierten Texte kaum vermuten würde und der meine Schilderungen von den Ereignissen im Affensaal sofort lebhaft in eine zeitungstaugliche Affäre umschrieb. Der Streiter wider die Angst, der während seiner Predigt selbst in Furcht darniederbricht – dieser Stoff stammte direkt aus Liegners Wunschträumen. Seine Geschichte gebar sich schon während unseres Gesprächs, die weiteren Recherchen waren – wie bei allen Meisterstücken des Boulevards – nur belanglose Nachwehen. Meinen zweiten Zeugen, den ich ihm neben Gabriel Gotthelf namhaft gemacht hatte, rief er gar nicht mehr an, um seine Story abzusichern.
Vielleicht, so philosophierte ich ein wenig platt, konnte man die banale Wirklichkeit, wie sie von schrägen medialen Meisterköchen für ihr ergebenes Publikum konzentriert, gewürzt und aufbereitet wird, gar nicht trefflicher enttarnen als durch unsere Komödie. Doch gab ich gerne zu, dass dies alles nie als Experiment gedacht, sondern einfach eine verrückte, weinselige Idee gewesen war.
Jedenfalls wurde nie publik, dass in diesem Fall im „Volksblatt“ nachweislich von einer Begebenheit zu lesen war, die schlicht und einfach nicht stattgefunden hatte. Und offenbar waren auch meinem Ex-Kollegen Robert niemals Zweifel gekommen. Denn zehn Jahre nach dem sagenhaften Bericht von der „Panik im Affensaal“ trug ich ihm die Information von Gabriel Gotthelfs Ableben zu – und prompt verfasste er für die Ausgabe vom 8. September 2009 einen Einspalter, den ich als Faksimilie für den Schluss meiner Dokumentation vorgesehen hatte. Ich zitierte:
„Esoteriker in Italien gestorben.
Am Sonntag kam bei einem Verkehrsunfall der bekannte Esoteriker Gabriel Gotthelf (58) ums Leben. Gotthelf hatte für Schlagzeilen gesorgt, als er vor Jahren während eines Vortrages zum Thema Angstfreiheit mit einer Schusswaffe bedroht worden war. Die Hintergründe des Falles konnten nie geklärt werden.“
Das letzte Puzzleteilchen. „Es war der Unfalltod Ihres Bruders“, erklärte ich, „der mich auf die Idee gebracht hatte, Robert Liegner nochmals anzurufen, der Wunsch, ihm einen angemessenen Nachruf zu bieten. Und daraus entstand zuletzt die ganze Geschichte!“
Dr. Moser nickte beeindruckt. „Die Geschichte zweier Rivalen, die nie gelebt haben, über deren Konfrontationen aber Zeitungsberichte existieren, die es aber wiederum nur deshalb gibt, weil sie konstruiert wurden – eine bemerkenswerte literarische Sonderbarkeit!“
Natürlich war uns beiden klar, dass eine solche Erzählung provozieren könnte. Wer nicht nach Hintergründen suchte, mochte sich einfach an der Komödie erfreuen. Wer indes den Ich-Erzähler als Zeugen für tatsächliche Gegebenheiten unter Eid stellte, konnte sich über den Missbrauch biographischer Daten herzlich empören. Die wenigen literaturbewegten Geheimnisträger aber wussten ohnehin, dass es kein Geheimnis gab: In Texten liegt immer genau so viel Wahrheit, wie sie starke Momente des Lebens widerspiegeln.
An dieser Stelle entschuldigte sich Dr. Moser flüchtig, rief theatralisch „In vino veritas!“ in den Raum und durcheilte die Bibliothek in Richtung Küche, um mit Gläsern und Flasche zurückzukommen.
Wir verbrachten den Nachmittag im Geiste schöner südsteirischer Weißweine und gedachten dabei eines Menschen, der wie der Herbstwind war: Wenn es ihm zu bunt wurde, konnte es passieren, dass der Meister der Entblößung loslegte und alle Blätter fielen. – – –
III.
Gleich nachdem ich diesen letzten Absatz formuliert hatte, unternahm ich etwas, das ich üblicherweise streng vermeide, solange ein Text noch nicht restlos von mir fortgeschrieben ist: Ich gab ihn meiner Frau zu lesen – einem liebevollen, bodenständigen Wesen, das sich zwar vorrangig für gute Speisen und üppig wuchernde Gartenpflanzen begeistert, aber auch eine Neigung zur streitbaren Literaturkritikerin in sich trägt. Jedenfalls betätigt sich Gudrun, sobald ich ihre Meinung zu einer Arbeit erbitte, als beckmesserische Lektorin und Sprachrohr eines imaginären, äußerst anspruchsvollen Publikums, zu dem ich noch kaum rechten Kontakt fand; denn es erwartet von mir gemütvolle, unkonstruierte Erzählungen, frisch aus dem Leben, zugleich aber eine wenigstens kleine literarische Sensation.
Dennoch setzte ich in diesem besonderen Fall das Wohlwollen meiner lieben Frau voraus, umso mehr, als sie ja einige Momente dieser Erzählung aus ihrem eigenen Leben wieder erkennen musste. Aber ich ersehnte Gudruns Begeisterung vergeblich.
Nach der Lektüre durchmischte sie in Unheil verkündenden Wehen wieder und wieder die Seiten des Manuskripts, bis endlich die Leserschar aus ihr herausbrach und mir vorhielt, in allzu verwirrender Weise zwischen tatsächlichen Begebenheiten und getürkten Zeitungsberichten hin und her zu schlürfen.
Meine schwache Rechtfertigung, dass es sich doch um einen frei erfundenen Text handle – die Brüder Mühlbach/Moser gab es schließlich ebenso wenig wie Robert Liegner und seine Redaktion –, zählte für Gudrun nicht. Auch mein Credo, dass im Grunde doch jede Erzählung in ihren besten Momenten mit herausragenden Begebenheiten und Empfindungen spiele und die Handlung immer nur ein unbedeutender Rahmen für eben diesen Zweck sei, was ich einmal auch zum Ausdruck bringen wolle, schallte an ihr vorbei. Daraufhin hatte ihr noch meine Absicht verdeutlichen wollen, mit dieser Erzählung die ewige Frage nach dem autobiographischen Gehalt eines Textes ad absurdum zu führen, aber Gudrun unterbrach mein Dozieren: „Ach“, schmetterte sie mich nieder, „Geschichten, für die man eine Gebrauchsanweisung benötigt, sind uns Lesern sowieso suspekt.“
Ich nahm ihr das Manuskript also zärtlich aus der Hand, und wir erfreuten uns an einem gemeinsamen Abend mit griechischen Liedern, ordentlich harzigem Retsina und passenden bunten Gedanken.
Den Text brachte ich in einer stillen Stunde allein zu Ende.
IV.
Und damit, geschätzte Leserschaft, sollen auch die beiden letzten Hüllen fallen, die die nackte autobiographische Wirklichkeit noch zart bedecken.
Ich gestehe frei heraus, dass es in meinem Leben keine Frau namens Gudrun gibt.
Vor allem aber muss ich mich selbst aus dieser Arbeit schreiben. Es gibt mich nicht. Denn der frei schöpfende Autor hätte den Geschichten aus dem Leben, von denen diese Erzählung berichtet, abgesehen von Namen und Rahmen nur wenig hinzuzufügen.

Grafik: Hans Beletz