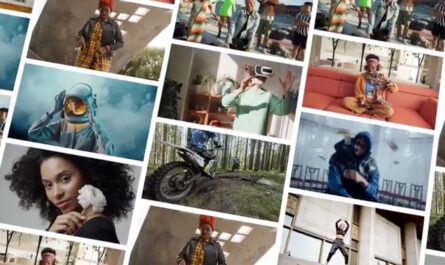Begriffe wie „Online-Overkill“ und „digitale Demenz“ sind populär geworden. Einige Psychologen zeichnen das Schreckgespenst dummer, kranker und erfolgloser Passiv-Menschen, die sich „das Gehirn weggeklickt“ haben und ohne ihre „Internet-Nabelschnur“ nicht mehr leben können. Eltern müssen hilflos zusehen, wie Facebook, Instagram & Co das Bewusstsein ihrer Sprösslinge bindet und kein Gespräch, keine Mahlzeit, keine Schulstunde und kein Kinobesuch ohne das permanente Schielen auf Neuigkeiten aus dem Netz mehr möglich ist. Wie groß sind die Gefahren des mobilen Internets wirklich? Wie verändert sich unser Inneres durch diesen Großversuch an der Menschheit? Sind die Warnungen berechtigt – oder letztlich doch nur ein Ausdruck von Kulturpessimismus, wie es ihn seit Jahrtausenden gibt?
Endgültig wird die Frage, ob die technische Vernetzung der Menschheit ein Segen war oder ein Fluch, wohl erst in fernerer Zukunft beantwortet werden können. Derzeit ist lediglich klar, dass sich an der Dominanz des Internets nichts ändern wird. Die Vorteile des vernetzten Arbeitens sind breit gefächert, und ein Zurück in die „guten alten Tage“ ohne Netz und Bildschirm wünscht sich kaum jemand, der die Möglichkeiten durch die neuen Technologien kennen- und schätzengelernt hat.
Absehbar ist aber auch, dass das Internet unsere Gesellschaft weiterhin verändern wird – und diese Veränderungen sind vermutlich tief greifend, so dass es an der Zeit ist, ihnen klare Ziele und begleitende Rahmen beizustellen, damit sie nicht völlig außer Kontrolle geraten. Denn angesichts der Tatsache, dass allein in Deutschland bereits etwa 250.000 Vierzehn- bis Vierundzwanzigjährige als internetabhängig gelten und 1,5 Millionen als „problematische Internetnutzer“, stehen wir bereits jetzt vor einem Problem.
Kulturpessimismus ist kein Rezept
Das rigorose Ablehnen alles Neuen mit dem Hinweis darauf, dass es „früher doch auch ohne Technik-Firlefanz“ ging, ist ein altbekanntes Konzept. Schon immer reagierten Teile der Gesellschaft beim Aufkommen einer neuen Technologie mit Kulturpessimismus. Beispiele aus der Geschichte gibt es dafür genügend: Fernsehen mache blind, warnte man im vergangenen Jahrhundert, und die Einführung der Straßenbeleuchtung sei gesundheitsschädigend. Platon verurteilte einst sogar die Technik des Schreibens: „Wer die Schrift gelernt haben wird, in dessen Seele wird zugleich mit ihr viel Vergesslichkeit kommen, denn er wird das Gedächtnis vernachlässigen. Die Menschen werden jetzt viel zu wissen meinen, während sie nichts wissen.“
Aus dem Jahr 1795 ist eine Aussage des Pfarrers Johann Rudolph Gottlieb Beyer überliefert, der sich strikt gegen das Lesen richtete. Es führe zu „Schlaffheit, Verschleimung, Blähungen und Verstopfungen in den Eingeweiden, namentlich zu Hypochondrie, die beim weiblichen Geschlecht, recht eigentümlich auf die Geschlechtsteile wirkt.“
Als der Film neu aufkam, mahnte der Kunsthistoriker Konrad von Lange (1855–1921): „Die dargestellten Vorgänge verlangen geradezu das Ausschalten jeder Denkkraft, so dass sie, öfter genossen, geradezu verdummend auf den Geist wirken müssen.“
Es gäbe noch weitere ähnliche Beispiele. Zweifellos ist Kulturpessimismus kein Rezept. Eine solche Haltung konnte noch nie etwas verhindern oder rückgängig machen. Daher wird es heute auch bei den Entwicklungen rund um das Internet nichts nützen, sie zu dämonisieren und so zu tun, als handle es sich um außerirdische Invasionstechnologien, die auf die Zerstörung der Menschheit abzielten.
Ein alles verklärender „Romantikmodus“ hilft nicht weiter. Eine Welt ohne Internet, ohne Computer, vielleicht auch ohne Strom – wäre sie wirklich ideal? Würden zeitraubende Verpflichtungen wie Holzmachen, Jagen, kilometerlange Botengänge mangels Telefons wirklich automatisch auch die geistige Entwicklung fördern?
Der „digitale Graben“ wird tiefer
Wahrscheinlich ist die Vorstellung, ein aus dem Streben des Menschen hervorgegangenes Kulturwerkzeug sei verantwortlich für alle Unbill der Gegenwart, letztlich doch wieder nur ein unbewusster Versuch, Verantwortung abzuwälzen. Zwar kann nicht geleugnet werden, dass das Internet neben den vielen Nutzanwendungen auch ein erhebliches Gefahrenpotential birgt. Mit einem einfachen Mausklick kann jedes Fenster am Bildschirm sekundenschnell in Abgründe führen, Gedanken an Leidenschaften binden und dem Leben in der physischen Welt entfremden. Doch Technologie verstärkt und beschleunigt immer nur das Wollen des Menschen. Auch das Internet bringt letztlich nur das ans Licht, was in menschlichen Seelengründen ruht und nach Entfaltung drängt.
Deshalb ist vor allem ein verantwortungsvoller Umgang mit den technologischen Möglichkeiten nötig, damit Fehlentwicklungen vermieden werden können. Doch dies erfordert Wachsamkeit und Lernbereitschaft auch bei allen Erziehungsberechtigten, damit der „digitale Graben“ nicht noch tiefer wird. Dieser Begriff beschreibt eine Kluft zwischen den Generationen:
Junge Menschen erleben im Hinblick auf das mobile Internet praktisch keine Führung, keine Grenzen, da die Erziehungsberechtigten selbst keine oder zu wenig Ahnung von der Technologie haben. Erwachsene beispielsweise, die sich vor wenigen Jahren dazu durchringen konnten, ihren persönlichen Schriftverkehr weitgehend vom Briefeschreiben auf E-Mail umzustellen, gehören damit längst zum „alten Eisen“. Jugendliche benutzen zum Informations- und Gedankenaustausch einfach soziale Netzwerke wie „Facebook“, „WhatsApp“ oder andere Möglichkeiten im sogenannten „Web 2.0“. Dieses Schlagwort beschreibt die Entwicklung des Internets zu einer von allen Menschen gemeinsam gestalteten Plattform, während davor alle Inhalte – ähnlich wie in der physischen Welt – von vergleichsweise wenigen Organisationen oder Einzelpersonen bereitgestellt und von den anderen einfach konsumiert worden waren.
Wie dieses Beispiel zeigt, wiederspiegeln – und fördern – die Entwicklungen im Internet grundlegende Verhaltensänderungen. Auch wer von Kulturpessimismus weit entfernt ist, sollte daher mögliche Gefahren erkennen und ihnen bewusst entgegentreten. Denn kritiklose Technik-Euphorie ist mit Sicherheit auch kein brauchbares Rezept. Das beweisen viele aufsehenerregende Fakten aus Untersuchungsergebnissen.
Die Gefährdung der Persönlichkeit
Für viele ist es heute bereits üblich geworden, jeden „Atemzug“, den sie tun, jedes kleinste Lebensereignis ins Netz zu stellen, damit ihnen von anderen virtuell auf die Schulter geklopft wird. „Gefällt mir!“, lautet der ersehnte Kommentar. Dass der Mensch umso angreifbarer und schutzloser wird, je mehr Intimes er öffentlich von sich preisgibt, ist naheliegend. Und dass unreflektierte Kommunikation meist niveau- und anspruchslos verläuft, also die geistige Arbeit eines tieferen Nachdenkens von vornherein verhindert, zeigt die Praxis ebenfalls.
Untersuchungen haben erwiesen, dass viele Texte aus dem Internet nur noch „oberflächlich abgeschöpft“ werden. Statt in die Materie einzudringen, gleitet der Leser (oder besser: der Betrachter) über sie hinweg – man spricht deshalb ja auch sehr treffend vom „Surfen“ im Internet. Die Gefahr, dass mit der körperlichen „Erstarrung“ vor dem Bildschirm – etwa jeder fünfte deutsche Jugendliche verbringt täglich mindestens sechs Stunden vor dem Computer oder Fernsehen – gleichzeitig auch die innere Bewegung auf der Strecke bleibt, ist also durchaus real.
Dazu kommt das offensichtlich enorme Suchtpotential des Internets. Allein in Deutschland weisen etwa 560.000 Menschen klare Anzeichen von Internetsucht auf – sie „bewegen“ sich 30 bis 35 Stunden pro Woche zum reinen Vergnügen im Netz oder leiden unter Schlaflosigkeit, weil sie auch nachts nicht davon loskommen. Sie können ihren Medienkonsum nicht mehr kontrollieren und verlieren die Fähigkeit, ihre Zeit sinnvoll einzuteilen. Abstinenzzeiten werden mit körperlichem und seelischem Unwohlsein quittiert. Für den in der Suchtschleife hängenden „Nutzer“ haben die Weiterführung des jüngsten Internet-Spieles oder die Lust auf „Chats“, „Tweets“ oder „Onlinedates“ hohe Priorität im Alltag, und er verliert nach und nach die Kontrolle über wichtige Bereiche seines Lebens.
Für alle Suchtstoffe gilt die Regel: Je mehr davon da ist, desto mehr wird konsumiert. Kein Wunder also, dass das mobile Internet durch die weite Verbreitung von Smartphones und Tablet-Computern dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen permanent „on“ sind – wobei diese Kurzform für „online sein“ so ähnlich klingt wie „auf Droge sein“ …
Die Auswirkungen des immensen Medienkonsums sind in ihrer ganzen Bandbreite noch nicht abschätzbar. Im Augenblick ist die Situation mit einem gigantischen Feldversuch vergleichbar, dessen Ende völlig offen ist. Der Psychologe Prof. Dr. Manfred Spitzer warnt zum Beispiel von dem Dauerstress, der unbemerkt durch das Dauerbombardement mit digitalen Nachrichten entstehe. Dieser zerstöre Nervenzellen und schaffe dadurch einen „neurologischen Rahmen“, der nur noch wenig Raum für Kreativität und Spontaneität ließe.
Kurz gesagt: Der „Druck“ aus dem Internet, die Summe der kleinen Ablenkungen, Reaktionsaufforderungen und verführerischen Erlebnisinhalte, schwächt und gefährdet die Persönlichkeit. Er benötigt ausreichenden „Gegendruck“: Selbstkontrolle und klare Ziele. Vielleicht bemerkt so mancher selbstkritische Mensch erst angesichts der Lockungen des Internets, wie wichtig es für ihn ist, wollen zu lernen …
Die Gefährdung kultureller Fähigkeiten
Es zeigt sich auch, dass die unkritische Nutzung digitaler Medien wichtige kulturelle Fähigkeiten verändert oder gefährdet.
Clifford Stoll, US-amerikanischer Internet-Experte und -Kritiker in Personalunion, wies zum Beispiel auf die Verflachung des Schreibstils für das Internet hin: „Wenn Sie für das Web schreiben, müssen Sie kurze Absätze schreiben, die völlig selbsterklärend sind. Hypertext zerstört das Geschichtenerzählen. Es tötet die Erzählung. […] Computer sind das perfekte Medium um kurze Sachverhalte darzustellen, garniert mit hübschen Bildchen.“ Insgesamt aber mache das Internet uns nicht mehr, sondern weniger gebildet.
Nicolas Carr, ein US-amerikanischer Journalist, der sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalen Revolution beschäftigt hat, kam zu dem Schluss, dass der Mensch durch intensive Internet-Nutzung auf Dauer die Fähigkeit verliert, sich zu konzentrieren und strukturiert nachzudenken. Auch das Lesen habe sich verändert, es sei sprunghafter geworden.
Das von immer mehr Menschen heute geübte „Multitasking“, also das gleichzeitige Benutzen mehrerer Medien – Telefonieren und gleichzeitig mit dem Computer arbeiten oder etwas schreiben und gleichzeitig über „Facebook“ tratschen –, stört die Konzentrationsfähigkeit besonders. Der deutsche Psychologe und Internet-Kritiker Prof. Dr. Manfred Spitzer formulierte diesbezüglich im „Hamburger Abendblatt“: „Eine wissenschaftliche Untersuchung zur geistigen Leistungsfähigkeit von Menschen, die viel mediales Multitasking betreiben, ergab, dass alle Fähigkeiten, die beim Multitasking eine Rolle spielen, in entsprechenden Tests bei Multitaskern schlechter ausfallen. Sie können sich nicht so gut auf das Wesentliche konzentrieren, sind leichter ablenkbar und können nicht einmal besser zwischen unterschiedlichen Aufgaben hin- und herwechseln als Nicht-Multitasker. Im Gegenteil: Sie können all dies deutlich schlechter. Mit anderen Worten, wer noch keine Aufmerksamkeitsstörung hat, der kann sie sich durch Multitasking antrainieren.“
Der amerikanische Hirnforscher Gary Small, Leiter der „Memory and Aging Research Center“ an der Universität von Los Angeles, sagt, dass die Nutzung der neuen digitalen Medien massiven Einfluss auf die Gehirnentwicklung ausübt. Bei Kindern und Jugendlichen, die viel Zeit mit Smartphones, Nintendos und Computern verbringen, beobachtete er eine „Schwächung der neuronalen Schaltkreise, die für den zwischenmenschlichen Kontakt zuständig sind“. Sie seien deshalb zum Beispiel schlechter in der Lage, körpersprachliche Signale ihres Gegenübers zu deuten oder auch vorausschauend zu planen und abstrakt zu denken. Auch sei es schwer für sie, ihre volle Aufmerksamkeit auf eine Sache zu lenken oder über längere Zeit zuzuhören, weil sie an eine rasche Abfolge von visuellen und auditiven Reizen gewöhnt seien. Sie zeigten vermehrt Symptome einer Aufmerksamkeitsdefizitsstörung (ADHS), befänden sich in einem „Zustand fortgesetzter partieller Aufmerksamkeit“: Das Gehirn ist dabei in ständiger Alarmbereitschaft und hält ununterbrochen Ausschau nach einem neuen Kontakt oder einer spannenden Neuigkeit oder Information. Menschen können auf diese Weise zu „Stimulus-Junkies“ werden – sie brauchen immer neue Reize, um Gefühlen wie Langeweile auszuweichen und scheuen Ruhe, Kontemplation und Selbstreflexion. Mit anderen Worten: Während das Gehirn auf Hochtouren läuft, führt das eigentlich Menschliche nur noch ein trauriges Schattendasein …
In seinem Buch „Warum Computer nichts im Klassenzimmer zu suchen haben und andere High-Tech-Ketzereien“ verweist Clifford Stoll auf die großen Probleme, die „Internet-Kids“ wegen der permanenten Ablenkungsgefahr mit Aufgaben haben, die Disziplin verlangen. Sie seien daran gewöhnt, sich „im Netz treiben zu lassen“ und das Wertvollste zu vergeuden, was einem zur Verfügung stehe – Lebenszeit.
Auch die Fähigkeit, tiefer zu schürfen, um Antworten auf drängende Fragen zu finden, kann verlorengehen. Clifford Stoll meint, dass das Internet dazu verführt, „schnelle, einfache Fragen zu stellen“, statt einer Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Prof. Dr. Spitzer formuliert in diesem Zusammenhang: „Wer sich wirklich Wissen aneignen will, muss sich aktiv damit auseinandersetzen, Inhalte hin- und herwälzen, immer wieder durchkneten, infrage stellen, analysieren und die Inhalte neu zusammensetzen. Das ist etwas ganz anderes als das Übertragen von Bits und Bytes von einem Speichermedium zum anderen. Wer nur mit Copy and Paste arbeitet, versteht nichts wirklich und kann sich nichts merken. Die für das Lernen notwendige Tiefe geistiger Arbeit wurde durch digitale Oberflächlichkeit ersetzt.“
Dazu kommt ein Qualitätsproblem: Wer heute etwas „googelt“, verlässt sich dabei nur zu leicht auf die automatisch generierten Ergebnisse, ohne deren Herkunft genau zu unterscheiden. Wertlose Annahmen stehen deshalb häufig auf einer Ebene mit fundiertem, qualifiziertem Wissen. Im Hinblick auf die „Ökonomie von Informationen“ sei das Internet, meint Clifford Stoll, den traditionellen Wegen der Informationsbeschaffung nicht automatisch überlegen. „Nur wenn Sie extrem erfahren sind, können Sie auf dem Netz billig an gute Informationen kommen. Aber sie müssen Ihre eigene Zeit investieren. Wir denken immer nur, das Internet sei kostenlos. Ist es nicht. Und wenn sie glauben, das Internet sei schnell: Ist es nicht. Denken sie nur an die Download-Zeiten. The World Wide Wait! Die meisten Menschen glauben, Computer könnten besser denken als wir. Ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall.“
Nicht zuletzt weisen Studien auch auf psychosomatische Probleme durch übermäßigen Internet-Konsum hin. Vor allem über Schlaflosigkeit und Depressionen wird berichtet.
Dumm, krank und erfolglos?
All die kritischen Stimmen und Studienergebnisse zusammengenommen, spricht tatsächlich einiges dafür, dass das Internet dumme, kranke und erfolglose Menschen „generiert“. Zumindest liegt in der digitalen Welt ein erhebliches Gefährdungspotential.
Wobei die genannten Begriffe nicht allzu einseitig interpretiert werden sollten.
Eine übermäßige Internet-Nutzung führt nicht zu „Dummheit“ im Sinn von nicht mehr vorhandener Intelligenz. Untersuchungen haben nachgewiesen, dass die digitale Welt den Verstand sogar schärfen kann, dass internetgeprägte Menschen beispielsweise schneller auf visuelle Stimuli reagieren, große Informationsmengen rascher verarbeiten und schneller entscheiden können, was wichtig ist. Gehirnprozesse können also an Effizienz gewinnen. Die Frage ist aber: Gehört zum Menschsein nicht mehr? Was nutzt die ideale Technikaffinität, wenn die natürliche Lern- und Erkenntnisfähigkeit leidet? Wenn die Empfindung unterdrückt ist und sich die Intelligenz auf „kalte“ Informationsverarbeitung reduziert?
Sobald der Mensch seine Menschlichkeit verkümmern lässt, ist er wirklich dumm.
Was körperliche und psychosomatische Erkrankungen anlangt, die durch digitale Medien (mit)ausgelöst werden können, stehen uns vielleicht noch einige unliebsame Erkenntnisse bevor. Die immer weiter verbreitete Internet-Sucht, verbunden mit erheblichen Störungen der so wichtigen REM-Schlafphasen oder mit depressiven Verstimmungen, ist freilich schon schlimm genug. Aber es gibt noch weitere Hinweise auf Langzeitfolgen – sie reichen von verminderter Lern- und Orientierungsfähigkeit über Stressanfälligkeit bis hin zu den noch nicht abschätzbaren körperlichen Auswirkungen, die eine Langzeit-Nutzung von Mobiltelefonen nach sich ziehen wird.
Auch die Behauptung, durch Medienkompetenz und Übung im Umgang mit dem Internet automatisch besonders erfolgreich im Leben zu sein, muss sich auf dem Prüfstand erst noch bewähren. Zweifellos: Die digitale Welt erleichtert und beschleunigt viele Arbeiten erheblich. Aber mit Computern kann man eben auch „perfekt“ seine Zeit verschwenden, sich in Unwesentlichem, Nebensächlichem verirren – was beispielsweise dem beruflichen Erfolg nicht wirklich zuträglich ist.
Zweiffellos ist die Aufgeschlossenheit eines Menschen gegenüber neuen Technologien für manche Berufe wichtig und ein Indiz für gewisse persönliche Qualitäten. Allerdings nicht unbedingt für Vertrauenswürdigkeit. In einem interessanten Versuch haben Andrew K. Przybylski und Netta Weinstein von der University of Essex herausgefunden, dass Menschen, die sich zu einem Gespräch hinsetzen und dabei zuerst einmal ihr Mobiltelefon auf den Tisch legen, durch diese Handlung von ihrem Gegenüber bei persönlichen Themen vergleichsweise schlechte Bewertungen für Empathie und Beziehungsqualität erhalten. Diese Beurteilung erfolgt unbewusst. Die Forscher vermuten, dass das Mobiltelefon die Öffnung zum Gegenüber behindert und die Botschaft einer geteilten Aufmerksamkeit vermittelt: „Ich bin bereit, dieses Gespräch jederzeit stören zu lassen und zu unterbrechen, Du bist nicht so wichtig!“
Wie erfolgreich können Menschen sein, deren Aufmerksamkeit immer von Nebenschauplätzen wie Facebook oder dem Mail-Eingangsordner gefangen ist? Die zwar „Multitasking“ pflegen, aber immer nur alles horizontal-oberflächlich abarbeiten, ohne einen Zugang zur Tiefe oder Vielschichtigkeit eines Themas zu finden?
Eine Studie hat beispielsweise gezeigt, dass ein durchschnittlicher Büroangestellter täglich 49 Minuten dafür aufwendet, seine E-Mails zu verwalten. Pro Stunde kontrollierten die Studienteilnehmer, wie eine Beobachtungs-Software auf den Computern zeigte, ihren Posteingang 30 bis 40 Mal, der IQ fiel durch diese permanente Ablenkung um bis zu 10 Prozent.
Wissenschaftler der University of California kamen bei einer anderen Studie ebenfalls zu einem klaren Ergebnis: Wer von seinem Mail-Account abgeschnitten wird, arbeitet nicht nur fokussierter und produktiver, sondern auch unter deutlich weniger Stress.
Mehr Erfolg durch das Internet? Was heißt „erfolgreich“?
Man könnte den Begriff „Erfolg“ auch an der Frage messen, ob es einem Menschen gelingt, sich in seinem Leben persönlich zu entfalten und zu entwickeln, den tieferen Sinn in seinem Dasein zu entdecken und zu erfüllen, sich als empfindendes Geistwesen (und nicht nur als Verstandeswesen) zu erweisen. Und diesbezüglich dürfte Vorsicht geboten sein: Wer die vernetzte Welt, in der heute Gedanken und Gefühle kommuniziert werden, zugunsten dieses Erfolgs nutzen will, muss zweifellos sehr achtsam sein.
Was also tun?
Halten wir fest: Kulturpessimismus ist kein Rezept, kritiklose Technikgläubigkeit aber auch nicht.
Wir werden im Hinblick auf die Gefahren durch das Internet nicht umhin kommen, klarere Rahmenbedingungen zu definieren und einzuhalten. Sonst besteht wirklich die Gefahr, dass wir, wie Manfred Spitzer es in seinem Buch „Digitale Demenz“ ausdrückt, „uns und unsere Kinder um den Verstand bringen“.
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist natürlich die Quantität der Internetnutzung. Den Eltern wird empfohlen, mit ihren Kindern klare Regeln und Zeiten für die Computernutzung zu vereinbaren:
• Kinder sollten sich frühestens im Alter zwischen drei und fünf Jahren und täglich maximal 30 Minuten am Computer beschäftigen, später, bis zum Alter von zehn Jahren, maximal eine Stunde pro Tag.
• Im Jugendalter empfiehlt sich ein Wochenbudget von etwa acht Stunden. Gerade im Altersbereich zwischen 12 bis 15 Jahren wird viel „gechattet“; üblicherweise verändert sich dieses Verhalten erst, wenn eigenständige direkte soziale Kontakten gepflegt werden können („Face to face“ ersetzt „Facebook“).
• Wenn Eltern die zeitliche und inhaltliche Beschränkung der Computer- und Internetnutzung bei ihrem Kind nicht mehr durchsetzen können, sollte dies als Alarmsignal gewertet werden, das bereits auf ein suchtartiges Verhalten hinweist.
Äußerst umstritten sind derzeit – wohl zu recht – alle Bestrebungen dahingehend, den Schulunterricht möglichst früh mit digitalen Medien zu gestalten, um die „Medienkompetenz“ der Kinder zu erhöhen.
• Die Faustregel, „was man anfassen darf, das versteht man später auch“, lässt sich nicht ohne weiteres auf die Mensch-Computer-Interaktion übertragen. Wer mit der Maus auf etwas zeigt, „begreift“ es damit nämlich nicht. Studien zeigen zum Beispiel, dass Kinder über einen Lerngegenstand schlechter nachdenken können, wenn sie sich den Lernstoff in der Grundschule per Mausklick erschlossen hatten. Jedoch konnte keine Bildungsstudie beweisen, dass der Lernerfolg in der Vorschule sich durch den Umgang mit dem Computer verbessern würde.
• Ein guter, also dem Menschen dienlicher Umgang mit dem Werkzeug Internet kann nur erfolgen, wenn Kinder Zeit haben, die Welt zu erkunden und Erfahrungswissen zu sammeln. Kompetent wird ein Mensch durch echte sinnliche Erfahrungen, durch die Verschiedenartigkeit der Mitmenschen, das Erleben von Widersprüchen, durch das Verspüren von Empathie, aufgrund der Tatsache, dass der Nächste Leid und Ängste genauso erfährt und sich nach Glück genauso sehnt, wie man selbst.
• Wer für sein Leben einen roten Faden gefunden hat, wird die Informations-Fragmente im Netz eher sinnvoll nutzen können und nicht, wie es heute so oft der Fall ist, das Internet als Wissens- und vielleicht sogar Sinnlieferanten verstehen. Wer sich dagegen ohne eigene Erfahrungen, ausreichende Vorbildung oder mit mangelndem zwischenmenschlichen Kontakt vom Internet „inspirieren“ lässt, strandet mit einem Kopf voller neuer Probleme und dem Gefühl innerer Leere …
Der zunehmende Druck aus dem Netz verlangt nach Gegendruck – nach einer bewussten Lebensführung und einem hohen Maß elterlicher Verantwortung. Es liegt an uns, ob sich die neuen Technologien als Segen oder als Fluch erweisen – als Weg in eine lebenswerte Zukunft oder als Abstieg in die „digitale Demenz“, die Menschen zu dummen, kranken und erfolglosen Mitläufern degeneriert.
Hinweis: Dieser Text entstand in redaktioneller Zusammenarbeit mit meinem geschätzten Kollegen Mehmet Yesilgöz, Heilbronn