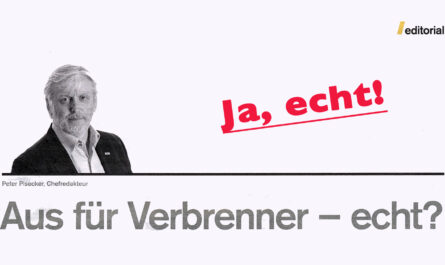Der Mensch trägt vorgeprägte Bilder in sich – bestimmte Vorstellungen davon, wie seine Umwelt, seine Mitmenschen oder auch er selbst zu beurteilen ist. Solche „Innen-Ansichten“ gibt es auch im Hinblick auf Gott. Sie sind gesellschaftlich, historisch und vor allem konfessionell bedingt, werden aber kaum einmal hinterfragt. Doch diese „Hintergrund-Bilder“ beeinflussen nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch das seelische Wohlergehen des Menschen. Manche konfessionellen Vorstellungen sind dabei nicht nur äußerst fragwürdig, sondern auch höchst gefährlich – Versuch eines Überblicks:
Vor-Stellungen: Es gehört zu unserer geistigen Entwicklung, dass sich auf der Suche nach Zusammenhängen, die das Leben bestimmen, fragwürdige oder falsche Bilder vor die Wirklichkeit stellen. Wie oft mussten wir in der Geschichte unser Weltbild revidieren, haltlos gewordene Ansichten überdenken, ein neues Selbstverständnis definieren. So weit, so gut – es wird dies wohl auch in der Zukunft noch häufig nötig sein.
Doch auf diesem natürlichen Entwicklungs- beziehungsweise Erkenntnisweg tun sich manchmal gefährliche Ab- und Irrwege auf, Sackgassen, die ein Fortschreiten erschweren oder unmöglich machen, weil sich eben irgendwie Vorstellungen eingenistet haben, die abwertend oder angsterzeugend sind und dem Leben entgegensteh. Es kann also nicht schaden, die eigenen inneren „Basisbilder“ zu hinterfragen, die sich ja in den Gemütshintergrund immer mit hineinmischen oder ihm sogar die wesentliche Couleur geben. Eine alte Parabel bringt das sehr treffend zum Ausdruck:
Falsches Silber
Ein reicher Mann, der ob seiner Hartherzigkeit weithin bekannt und gefürchtet war, kam zu einem alten Weisen auf Besuch. Er klagte bitter über die Schlechtigkeit der Welt, über den Ärger und Verdruss, den ihm alle Menschen bereiten und über die täglich wachsenden Sorgen um die Erhaltung und Mehrung seines umfangreichen Besitzes.
Der Weise hörte ihn ruhig an, erhob sich dann schweigend von seinem Sitz und führte den Reichen zum Fenster des Zimmers. „Was kannst Du durch dieses Fenster sehen?“, fragte der Weise.
„Ich sehe den Himmel, die Bäume und die Blumen, die Häuser und Straßen und alle Menschen, die sie beleben.“ Nach dieser Antwort des reichen Mannes nahm ihn der Weise sachte am Arm und führte ihn in das Zimmer zurück vor einen Spiegel, der an der Wand hing. „Was siehst du jetzt?“, fragte er ihn.
„Ich sehe im Spiegel nur mich selbst“, antwortete der Reiche.
„Und weißt Du auch, woher das kommt?“, fragte ihn der weise Alte und erklärte: „Beides ist Glas – das Fenster, wie auch der Spiegel. Doch hinter dem Glas des Spiegels ist Silber – und nur das Silber nimmt Dir den Blick auf die Welt: auf Himmel, Bäume, Blumen und Menschen – auf Deinen Nächsten. Deine Sorge um Dein Silber, um Deinen Besitz bewirkt es, dass Du nichts anderes siehst, als Dich selbst!“
Jeder einfache „Blick aus dem Fenster“ – hinaus in die Schönheit der Natur, aus deren Schoß wir ja geboren wurden –, könnte uns ganz unvermittelt innerlich anrühren: die Harmonie der Farben, Formen und Töne weckt Dankbarkeit, Vertrauen, auch ein Gefühl von Geborgenheit und Frieden, verbunden vielleicht auch der Gewissheit, dass all das Schöne ein Werk des erhabenen Schöpfers ist.
Leider aber bietet der Alltag eine Menge „falsches Silber“, das einen schlichten, empfindungsvollen Blick aus dem Fenster verwehrt und uns statt dessen nur die eigene Person vorspiegelt, also selbsterdachte Bilder und Vorstellungen von Gott und der Welt. Diese sind naturgemäß durch verschiedenste Einsichten, Absichten, Wünsche, Erfahrungen und Ziele geprägt und führen manchmal zu folgenschweren falschen Vorstellungen. Doch lassen sich gemeinsame Wurzeln für solche Entwicklungen beschreiben.
Abwertend, bedrohlich, unangemessen
Für den gläubigen Menschen gehört eine Vorstellung vom Sein und Wirken des Schöpfers zum „Lebenselixier“. Andererseits wollen viele mit Konfessionen heute nichts mehr zu tun haben; sie blenden Glaubensfragen bewusst aus. Doch kann es einem Menschen im Grunde seines Herzens wirklich gleichgültig sein, ob es eine Gottheit gibt oder nicht? Fest steht: Unser Verhältnis zu Gott kann für unsere Motive, Gedanken und Handlungen durchaus entscheidend sein.
Wer sich beispielsweise dem Atheismus verschrieben hat, weil er mit dem kirchlich geprägten Bild vom wunderwirkenden und seinen Sohn opfernden alten Vater absolut nichts anfangen kann, weil er aufgrund des Unrechts und Leides auf der Welt an keine höhere Gerechtigkeit mehr glauben will oder weil er sich selbst vom Leben schwer benachteiligt fühlt, der wird vor dem Hintergrund seiner eigenen Gottesferne vielleicht auch gar nicht mehr nach einem „höheren Willen“ fragen. Er wird sich gerne mit der Theorie begnügen, das ganze Leben sei ein Spiel des blinden Zufalls. Und bei entsprechender Veranlagung wird er sich ganz ohne schlechtes Gewissen rücksichtslos gegenüber seinen Mitmenschen ein möglichst großes Stück vom „Kuchen“ abscheiden. Wo der Bezug zu einer „höheren Instanz“ ganz fehlt, keine Geborgenheit im ganzen mehr erlebt werden kann, dort regiert das Prinzip des Nehmens ungeniert und ungehemmt – mit weit reichenden Folgen für die Gesellschaft.
Aber ist jemand, der die traditionellen Gottesbilder ernst nimmt, deshalb auf dem richtigen Weg? So einfach ist die Sache nicht. Die Vorstellung vom strafenden, argusäugig jede menschliche Regung beobachtenden Richter-Gott beispielsweise, wie sie vor allem durch die Texte des Alten Testamentes betont wird, ist ein idealer Nährboden für Ängste oder Schuldgefühle. Sie fördert eine Art von Ergebenheit, die jeder Persönlichkeitsentfaltung zuwider läuft und produziert eher Kirchenschäfchen als freie Menschen.
Aber auch der Gegenentwurf vom „zuckersüßen“, alle Menschenkinder umarmenden, bedingungslos liebenden Schöpfer, dessen Zuneigung man sich allein durch den Glauben erringen kann, wirkt unter Umständen lähmend. Er kann dem Antrieb zu sinnerfülltem Handeln zuwider laufen. Wer sich erlöst wähnt, weil er brav zur Kirche geht, beichtet oder Gebetsverse herunterleiert, wird kaum nach neuen Einsichten, Sinnzusammenhängen oder Entwicklungsmöglichkeiten suchen. Eben darnach drängt es einen freien, regen Geist jedoch.
Die Vorstellungen vom Sein und Wirken des Schöpfers können also durchaus gefährlich werden, sobald sie abwertende, angsterzeugende oder in irgendeiner Form unangemessene Tendenzen aufweisen. Ebenso ist es übrigens mit den Bildern von der Welt, in der wir leben. Wer davon ausgeht, dass sowieso alles unheilbar krank ist oder das ganze All letztlich nur ein Zufallsprodukt im übermächtigen Chaos, der wird aus diesem abwertenden Gedankenbild heraus von vornherein ausschließen, dass das Leben Sinn und Ziel hat.
Wer immer nur vom apokalyptischen Weltuntergang phantasiert – wie es in Kreisen mancher Esoteriker und Verschwörungstheoretiker üblich ist –, und täglich die große Katastrophe oder wenigstens den Ruin von Wirtschaft und Gesellschaft erwartet, der wird sich in seinem Faible für Bedrohliches schwer damit tun, die schönen Seiten des Seins zu erkennen, die Chancen und Möglichkeiten, die das Leben immer bietet. Und wer gedanklich nur illusionären Utopien und grotesken Scheinwelten nachhängt, der entzieht sich durch seinen stets verzerrten – und damit unangemessenen – Blick auf die Welt jenen realen Boden, der sicher durchs Leben führt.
Abwertend, bedrohlich oder unangemessen können nicht nur Gottes- und Weltbilder sein. Auch die Vorstellungen, die wir im Inneren von uns selbst und unseren Mitmenschen zeichnen, können gefährliche Schattierungen aufweisen. Wer sich und/oder die anderen geringschätzt, verachtet, ja, vielleicht sogar hasst, könnte als Zyniker und Pessimist enden. Jedenfalls aber wird dieses abwertende Selbst- und Menschenbild es ihm verschweren, brauchbare, entwicklungsträchtige Fähigkeiten in sich selbst und bei anderen zu entdecken und zu fördern.
Ebenso hemmend wirken auf der (zwischen)menschlichen Ebene bedrohliche Bilder: Wer in ständiger Angst um sich selbst lebt und/oder in seinen Mitmenschen tendenziell eher das Böse, Bedrohliche, Gemeine sieht, dessen unter Umständen chronisch misstrauische Gedanken werden irgendwie beständig um die eigene Sicherheit kreisen beziehungsweise Ängste schüren. Daß darin keine Freiheit liegt, versteht sich von selbst.
Zuletzt gibt es natürlich auch jede Menge unangemessener Selbst- und Menschenbilder. Dazu gehören beispielsweise die Unter-, aber auch die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten (bis hin zum Glauben, selbst Gott in sich zu tragen) oder entmündigende Vorstellungen, wie sie in vielfältigen Ausprägungen anzutreffen sind: die Meinung, im Leben sei ohnehin alles vorbestimmt, gehört ebenso dazu, wie etwa die Bereitschaft, seine eigene Gesundheit ganz in die „Verantwortung“ des Arztes oder Apothekers zu legen.
Wissen, Wertschätzung, Vertrauen
Die Frage ist nun, wie sich solche gefährlichen Gottes-, Welt-, und Menschenbilder korrigieren lassen, welche Wege aus falschen Vorstellungen hinausführen, damit der „Blick aus dem Fenster“ wieder etwas klarer und sehnsuchtserfüllter werden kann. Dazu einige Leitgedanken:
– Der wichtigste Anstoß zur Korrektur falscher Vorstellungen war schon immer (und ist noch immer) das Wissen. Wer Zusammenhänge erfasst hat, tut sich leichter, traditionell Bestehendes zu hinterfragen und nötigenfalls zu korrigieren.
Nun stehen wir aber vor dem Problem, dass gerade das zu einer grundlegenden Bildkorrektur nötige geistige Wissen heute kein Allgemeingut ist. Die „einhellige Fachmeinung“ über Gott gibt es nicht. Über Ursprung und Zukunft der Welt kann nur gerätselt werden, und was unser Menschsein anbelangt, so steht die psychoanalytische Fachwelt der Dimension des „Geistigen“ sehr skeptisch gegenüber.
Etablierte, allgemein akzeptierte Antworten auf die entscheidenden Fragen des Lebens wird man also nicht finden, und der Ausweg in „ungesicherte“ Bereiche kann brandgefährlich sein. Denn was heute beispielsweise auf der esoterischen Schiene abfährt, dieser kunterbunte Zug magischer Gespinste bietet letztlich keinen Halt. Auch wenn sich die Unzuverlässigkeit neuer Wege und Methoden meist rasch erweist, irrlichtert die Faszination daran als Strohfeuer von einem entzündbaren Ballen zum nächsten.
Auch wenn es keine Automatik gibt und gute Bildung nicht automatisch wie ein Radiergummi alle bedrohlichen, abwertenden oder unangemessenen Bilder aus dem Seelenhintergrund löscht, so ist das Wissen (auch um die Grenzen des Wissenkönnens) ein wichtiger Korrektur-Hebel.
– Wenn alte Vorstellungen durch neue, „schützende Bilder des Seins“ ersetzt werden sollen, so ist der vielleicht wichtigste Aspekt dabei die Wertschätzung. Werte lassen sich mit wenig Mühe immer finden – in sich selbst, in anderen Menschen, in jeder Lebenssituation. Dies mag im Hinblick auf Schicksalsschläge vielleicht provokant wirken. Aber tatsächlich können wir alles, was wir erfahren, einem Sinn zuführen. Sinnstiftendes Handeln ist immer möglich, und wenn es vorerst nur im beispielhaft mutigen Ertragen von liegen sollte.
– Zwei weitere „zauberhafte Begriffe“ sind Vertrauen und Geborgenheit. Sie vermögen angsterzeugende, bedrohliche Bilder ohne viel Aufhebens aus unserem Leben zu entlassen. In einer kleinen Symbolik von Idries Shah kommt dies sehr schön zum Ausdruck:
„Ein großer Strom hat auf seiner langen Reise durch die Welt gelernt, sich immer wieder durchzusetzen. Eines Tages erreicht er die Wüste und versucht, den Sand zu durchqueren. Doch so sehr er sich bemüht, er kommt nicht voran und wird zusehends aufgeschluckt. Das verdrießt den Strom, der doch bisher jedes Hindernis übertaucht hat. Er ärgert sich und grollt: ,Noch nie habe ich aufgegeben; soll ich ausgerechnet vor dem Sand kapitulieren?‘
Wie er so nachdenkt, flüstert ihm eine Stimme zu: ,Du musst dem Wind erlauben, dich über die Wüste zu tragen! Dazu musst du dich vom Wind aufsaugen lassen!‘
Lange sträubt sich der Strom dagegen. Er ist zu stolz und zu skeptisch. Noch nie hat er fremde Hilfe in Anspruch genommen. Sich vom Wind aufsaugen lassen … bedeutet das nicht so viel wie sich verlieren? Doch zuletzt treibt der Mut der Verzweiflung den Strom an, sich selbst zu riskieren.
Er lässt sich aufsaugen und als Wasserdunst in den offenen Armen des Windes über die Wüste tragen. Auf den Spitzen des fernen Gebirges fällt er als weicher Regen nieder und findet sich als Quelle wieder. Er erinnert sich, daß sein Leben buchstäblich in den Sand geschrieben ist. Der Strom hat sich riskiert und beginnt ein neues Leben.“ (1)
Das hier gleichnishaft beschriebene „Sich-selbst-Riskieren“, das Überwinden der gewohnten „Flussbahnen“, das „Sich-vom-Wind-tragen-Lassen“, das dem Sich-vom-Leben-führen-Lassen gleichkommt, fördert das Vertrauen in sich selbst, in die Welt, in den Schöpfer, und es vermittelt zugleich Geborgenheit. Selbstredend soll das nicht zu waghalsigen Risikounternehmungen ermuntern. Nein, es geht um etwas ganz und gar Durchschnittlich-Normales, jedem Menschen Zumutbares, das übrigens auch in einem Christus-Wort zum Ausdruck kommt:
„Sehet die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen. Und Euer himmlischer Vater nähret sie doch.“ (2)
Damit ist das Vertrauen des Geschöpfes in seinen Schöpfer angesprochen. Die Gedankenfabrik, die unentwegt nur Ideen zur eigenen Sicherheit und zum eigenen Wohlergehen produziert, kann getrost auch einmal still gelegt werden. Offenen Herzens hinaus in die Welt! Neuland erforschen! Die Erfordernisse des Augenblicks erkennen, denn mit ihnen kommuniziert das Leben! Glück und Mühsal als Gelegenheiten erkennen. Das kann das Urvertrauen fördern und helfen, angsterzeugende, bedrohliche Bilder des Seins zu überwinden.
Doch nicht nur das: Jedes Sich-selbst-Riskieren, also das Sich-Erheben über selbsterdachte Sicherheits- und Wohlstandsbahnen im Sich-selbst-vom-Leben-tragen-Lassen, das vertrauensvolle Zulassen von Sonnenschein und Regen im Erleben fördert noch etwas anderes: die Erkenntnis nämlich, dass unser Wesenskern die Freiheit hat, sich von der seelischen Befindlichkeit zu distanzieren, dass wir also ein allem Physischen und Psychischen übergeordneter Funke sind: Geist! Und diese Erfahrung des Eigentlich-Menschlichen ist für die Ewigkeit besser geeignet als alle theoretischen Vorstellungen über Gott, die Welt und den Menschen.
Literaturhinweise:
1 Lukas Elisabeth, Verlust und Gewinn – Logotherapie bei Beziehungskrisen und Abschiedsschmerz (Edition Logotherapie, Band 5), Profil-Verlag, München/Wien 2002
2 Neues Testament, Matth. 6, 26