Zehn Bergbau-Anekdoten zur Geschichte der Weststeiermark
• 1. Kohle macht blind
 Es ist nicht allzu lange her, da wusste noch kein Mensch, was er mit einem so seltsamen Erdgewächs wie Kohle anfangen sollte. Aus dem Jahre 1674 ist überliefert, dass man dieses Fossil voller Neugier auf seinen Metallgehalt überprüfte. Wen wundert es da noch, dass Ferdinand Wilhelm Rudolfi, der sich 1716 um die Kohlengrube bei Fohnsdorf bewarb, aus dem schwarzen Etwas „ein für Mensch und Vieh heilsames Öl destillieren“ und aus der Asche Salpeter gewinnen wollte.
Es ist nicht allzu lange her, da wusste noch kein Mensch, was er mit einem so seltsamen Erdgewächs wie Kohle anfangen sollte. Aus dem Jahre 1674 ist überliefert, dass man dieses Fossil voller Neugier auf seinen Metallgehalt überprüfte. Wen wundert es da noch, dass Ferdinand Wilhelm Rudolfi, der sich 1716 um die Kohlengrube bei Fohnsdorf bewarb, aus dem schwarzen Etwas „ein für Mensch und Vieh heilsames Öl destillieren“ und aus der Asche Salpeter gewinnen wollte.
Kohle für Heizzwecke? An so Absurdes dachte lange Zeit niemand. Und selbst als die Pioniere in der Industrie des 18. Jahrhunderts begannen, Kohle als Ersatz für den Brennstoff Holz zu verwenden, hatte man gegen massive Proteste seitens der Öffentlichkeit anzukämpfen. Die Argumente gegen eine Verwendung der (damals so genannten) „Steinkohle“ waren vielfältig – und noch dazu medizinischer Natur: Das Verbrennen von Kohle verursache durch den dabei entstehenden üblen Geruch Kopfschmerzen und, so hieß es, „wegen des allzu starken Geschmackes kann die Kohle im Winter in den geschlossenen engen Werkstätten nicht verwendet werden“.
Vor allem aber meinte man, „Kohle macht blind!“, zumindest verdirbt sie die Augen … wo sie doch selbst so dunkel ist!
Schließlich setzte sich aber doch die Erkenntnis durch. In der Weststeiermark nahm im Bereich der eisenverarbeitenden Industrie das 1788 vom Gewerken Georg Gamillschegg in Krems bei Voitsberg errichtete Blechwerk eine Vorreiterrolle ein. In den dortigen Glühöfen kam bereits um 1800 heimische Braunkohle zum Einsatz.
Im Bereich der Glasindustrie war es die Hütte Oberdorf bei Bärnbach, die 1805 in unmittelbarer Nähe der reichen Kohlenlager des Gewerken Johann Michael Geyer gegründet wurde und 1806 in Betrieb ging, die als erste steirische Glashütte mit Kohle heizte. Im Jahre 1806 lieferte der Gewerke Geyer bereits etwa 470 Tonnen Kohle an diese Hütte. Der Rest ist Bergbaugeschichte.
Denn es erkannt’ so manch‘ Gemüt,
dass Kohle doch am längsten glüht …
2. Goldfieber im Sallagraben
 Nicht nur die Kohlengewinnung prägte maßgeblich die weststeirische Geschichte, sondern auch die Suche nach anderen wertvollen Bodenschätzen. Allerdings kamen dabei nicht immer ganz lautere Mittel zum Einsatz.
Nicht nur die Kohlengewinnung prägte maßgeblich die weststeirische Geschichte, sondern auch die Suche nach anderen wertvollen Bodenschätzen. Allerdings kamen dabei nicht immer ganz lautere Mittel zum Einsatz.
Der Schurfbau „Theresienstollen“ im Sallagraben um 1932 steht im Mittelpunkt der ersten Geschichte: Emmerich Herzog war auf der Suche nach den Schätzen dieser Erde. Zehn Arbeiter, die er von der GKB, einem bedeutenden Bergbau-Unternehmen, abgeworben hatte, standen in seinen Diensten. Sie gruben sich in den Berg und trafen beim 95. Stollenmeter auf Schiefer und Quarzite, die mit Schwefelkies vererzt waren. Analysen des Gesteins wurden durchgeführt. Das Ergebnis – ein Zauberwort: Gold!
Zwar in Wirklichkeit nicht viel, nur 0,02 bis allerhöchstens 5 Gramm je Tonne Erz, aber da tauchte die Vision von „Mehr!“ auf: Der Stollen wurde auf 140 Meter verlängert, und gleichzeitig suchte man um die Verleihung von 24 Grubenmaßen an. Dieses Gesuch wurde vom Revierbergamt Graz jedoch abgelehnt.
Wahrscheinlich wußte Emmerich Herzog schon sehr früh, dass sein Stollen, in den er investiert hatte, nichts wert war. Aber das Goldfieber im Sallagraben müßte sich vielleicht doch noch irgendwie gewinnbringend ausnützen lassen …!?
Gedacht, getan. Damit wirklich jeder glaubte, dass mit seinem „Theresienstollen“ im sogenannten „Farmwald“ (heute Bundesforste), südlich des vulgo „Puffing“, viel zu holen sei, half Emmerich Herzog ein wenig nach und „taufte“ das Pyrit mit Goldstaub. Die folgenden Proben sollten auf reiche Goldvorkommen schließen lassen und den Verkaufswert der Lagerstätte somit massiv in die Höhe treiben.
Allein, Herzog tat zuviel des Guten, er „impfte“ das Gestein mit einer Überdosis – und kühlte das Goldfieber damit völlig ab. Denn in den nun gezogenen Proben befand sich so viel Goldstaub, dass das niemand mehr ernst nehmen konnte und der Schwindel aufflog. Die Schurftätigkeit wurde eingestellt; der „Theresienstollen“ ist heute verbrochen. Was mit den zehn GKB-Arbeitern geschah, die im Dienste Emmerich Herzogs standen, ist nicht bekannt.
Und die Lehr’ aus der Geschicht’:
Häng’ allzu sehr am Golde nicht!
3. Der Beryllium-Betrüger
 Es muss ja nicht gleich Gold sein – man kann auch mit anderen wohlklingenden Namen betrügerisch tätig werden.
Es muss ja nicht gleich Gold sein – man kann auch mit anderen wohlklingenden Namen betrügerisch tätig werden.
Schon im Jahre 1929 erkannte man in den luftschlossigen Chefetagen eines gewissen Herrn Direktor Dr. Ing. K. Seidler den durchschlagenden Wert eines englisch klingenden Firmennamens: „The Beryllium-Company, Graz“. So nannte der Herr Direktor seine Firma mit Sitz in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Dieses Unternehmen wollte besonders hoch hinaus. Und weil offenbar schon damals nichts ohne Public relations und Werbung ging, trug „The Beryllium Company“ von Beginn an besonders dick auf: In Köflach, so wurde verlautbart, habe man ein reiches Beryllium-Vorkommen entdeckt. Wer bis dahin nicht wußte, was Beryllium war, nämlich ein in der Metallurgie verwendetes Material zum Härten von Nickel und Kupfer, konnte jetzt in jeder Zeitung nachlesen: „Die Bedeutung der werdenden Berylliumindustrie für Österreich und das Ausland“ und „Köflach wird den Beryllium-Gehalt der Welt decken“, schrieb so manch begeisterter Redakteur.
Die Kunde hört’ man wohl, und es fehlt’ auch nicht der Glaube: Die Nachricht vom sagenhaft reichen Berylliumvorkommen bei Köflach drang sogar bis nach Japan, wo Heeres- und Marineverwaltung in ihr Budget für 1951 einen Posten für den Ankauf steirischen Berylliums aufnahmen.
Und während man im trauten weststeirischen Bergbaurevier nächst dem Gasthaus „Zum lustigen Bauern“ tatsächlich einen Beryllium-Abbau versuchte, eine Zubringerstraße anlegte, einen Transformator aufstellte, eine (noch heute vorhandene) Baracke errichtete und von den umliegenden Bauern Gründe erhandelte, scharrte Herr Direktor Dr. Seidler (oder wie immer der kompromisslose Hochstapler auch wirklich heißen mochte) kräftig in den Startlöchern „for international connections“. Er hielt zahllose öffentliche Vorträge, wollte am Grazer Jakominiplatz ein Büro-Hochhaus errichten und beschäftigte dafür bis zu fünfzig Arbeiter, suchte mit großen Zeitungsinseraten Betriebsingenieure, Laboranten, Lohnbuchhalter und Bürochefs – und erntete stets freudigen Zustrom arbeitshungriger Menschen.
Manchmal war Herr Seidler sogar selbst vor Ort. So wird berichtet, dass er im Bergbaugelände des Nachts aus Norwegen importierte Berylliumkristalle ausstreute, die man sodann am nächsten Morgen „gewann“.
Und der Zweck aller Müh’: Seidler wollte an das Geld künftiger Aktionäre und Investoren. 1931 fand die Affäre mit der Verhaftung und Verurteilung des Schwindlers ein für viele Betrogene kaum befriedigendes Ende. Denn 800.000 Schilling (heute etwa 25 bis 30 Millionen Schilling oder 2,15 Millionen Euro) waren in den Wind zu schreiben. Und es bleibt nur die Erkenntnis:
Selbst schuld, wer auf Ehr’ vertraut,
Bei Schlössern, die aus Luft gebaut!
4. Erdöl aus Mooskirchen
 Schwarzes Gold! Erdöl! Reichtum! Solche Gedanken waren auch den Weststeirern nicht fremd.
Schwarzes Gold! Erdöl! Reichtum! Solche Gedanken waren auch den Weststeirern nicht fremd.
Als in Mooskirchen im einst versumpften Gebiet in einigen Gräben mit fast stehendem Wasser ein brauner Niederschlag – Ocker – sichtbar wurde und sich an der Wasseroberfläche ein leichter Ölfilm zeigte, klingelten in den Köpfen einiger Gemeindebürger die Kassen. Man war überzeugt, dass es in Mooskirchen Erdöl geben und die Suche nach dem „schwarzen Gold“ daher erfolgreich sein mußte.
Die Hoffnung auf großen Reichtum wuchs! Daher war man auch mit finanziellen Mitteln zur Aufschließung der „Erdölvorkommen“ nicht sparsam. Bald war ein Bohrturm für Versuchsbohrungen aufgestellt. Auch ließ man sich, erzählte der inzwischen verstorbene Gastwirt Hochstrasser aus Mooskirchen, etwas einfallen, um den Geldfluss für diese Bohrungen noch zu fördern: Man stürzte ein Fass Petroleum ins Bohrloch. Der Schwindel kam jedoch bald auf.
Die „Erdöl-Erzählung“ dürfte ihren Hintergrund in einer Versuchsbohrung haben, die im Jahre 1926 durch die Firma Raky-Danubia in Mooskirchen durchgeführt wurde. Diese Bohrung reichte bis in eine Tiefe von 376 m! Für die Mooskirchner allerdings gilt
… die traurige Moral von der Geschicht’:
Erdöl fließt bis heute nicht!
5. Bahnhof ohne Eisenbahn
 Die Bahn bringt den Aufschwung! Bringt wirtschaftliche Belegung, Umsatz und Wohlstand! Was also tut einer, der von solchem Aufschwung als erster profitieren will und seiner Zeit voraus ist? Richtig! Er baut einen Bahnhof – auch und erst Recht, wenn es noch keine Bahnlinie gibt.
Die Bahn bringt den Aufschwung! Bringt wirtschaftliche Belegung, Umsatz und Wohlstand! Was also tut einer, der von solchem Aufschwung als erster profitieren will und seiner Zeit voraus ist? Richtig! Er baut einen Bahnhof – auch und erst Recht, wenn es noch keine Bahnlinie gibt.
Und so wurde vor gut 100 Jahren an der Abzweigung Oswaldgraben-Gallmannsegg ein schmuckes, zweistöckiges, weststeirisches Bahnhofsgebäude errichtet. Das Haus steht heute noch – aber Eisenbahn fährt keine durchs Kainachtal.
Immerhin aber erinnert dieser einzigartige Bahnhof ohne Eisenbahn an ein Eisenbahn-Projekt, das seit 1890 in Abständen immer wieder diskutiert wurde: Gemeint ist die „Kainachtal-Bahn“, die von Voitsberg über Kainach und den Oswaldgraben weiter nach Knittelfeld führen sollte.
Schon vor der Jahrhundertwende versprach man sich viel von einer solchen Verbindung. Ausführliche Begehungen fanden statt, die Zeitungen berichteten groß über das Projekt – allein, es blieb beim frommen Wunsch.
Nach dem Ersten Weltkrieg gab es neuerlich Bemühungen. Am 13. Jänner 1920 fand sich im Stadtratssaal von Graz weststeirische Polit-Prominenz ein, und der Grazer Bürgermeister Muchitsch versicherte, dass auch die Landeshauptstadt alles daransetzen werde, „diesen notwendigen Bahnbau endlich einmal zu verwirklichen“. Ein engerer Arbeitsausschuss wurde gegründet, und in weiterer Folge kam es auch zu Versammlungen in Knittelfeld und Judenburg. Diese Städte waren sehr interessiert und zur finanziellen Unterstützung bereit, wenn sie auch jeweils für sich den Standort des „Kopfbahnhofes“ der neuen Bahnlinie beanspruchten. Aber weiter als bis zu geologischen Untersuchungen für den geplanten Basistunnel Salla-Lobminggraben kam man nicht.
Zuletzt war das Projekt einer Bahnlinie von Voitsberg nach Knittelfeld im Jahre 1985 im Gespräch, als ein Köflacher Politiker dem Verkehrsminister die Forderung nach der Errichtung einer entsprechenden Bahnlinie vorlegte. Heute, Jahre danach, wartet das Bahnhofsgebäude an der Abzweigung Oswaldgraben-Gallmannsegg immer noch auf seine Eisenbahn … Gut Ding braucht eben Weile.
Manches funktionelle Haus
ist seiner Zeit zu weit voraus …
6. Gewerkin Zang als „Heilige Barbara“
„Was and’re nicht nach meinem Willen tun, das mach’ ich einfach selbst!“
Dieses Motto zieht sich wie ein Leitmotiv durch das Leben des Herrn Gewerken August Zang. In der Zeit von 1870 bis 1904 prägten er und seine Familie, voran Gattin Ludovica, ganz wesentlich die Geschichte des weststeirischen Kohlenreviers – heute erinnern noch zwei Namen an die schillernden Persönlichkeiten von einst: „Zangtal“ und die „Ludovicagasse“ in Voitsberg.
Gewerkin Zang war bei den Knappen auf Grund ihrer sehr sozialen Einstellung überaus beliebt. Sie war es, die den Wunsch äußerte, man möge der Landschaft um die Kohlengruben im Tregistgraben doch den Namen „Zangtal“ geben. Das passte zu „Ihrer Majestät“: Täglich fuhr Gewerkin Zang in einer prächtig bespannten Kutsche vom Schloss durch die Stadt zu den Kohlengruben. Und eine Zeitlang überlegten die Zangs um ihrer Bequemlichkeit willen sogar ernsthaft den Bau einer Seilbahn, die von ihrem Schloss direkt zu den Kohlengruben führen sollte. Dass Gewerkin Ludovica Zang einst auch einem Maler für eine Knappenfahne als „heilige Barbara“ Modell saß (ihre markanten Gesichtszüge in dem betreffenden Bildnis sind bis heute dokumentiert), darf als Abrundung des herrschaftlichen Bildes betrachtet werden.
… denn selbst als Barbara – in Ehren –
muss’ der Konkurrenz man sich erwehren!
7. „Koks“ aus Oberdorf
 Es war um 1924 und 1925, als man im Bergbauunternehmen GKB das aufsehenerregende Gerücht vernahm, man hätte in Polen aus Oberdorfer Kohle Koks hergestellt. Dies war nicht nur erstaunlich – es war eine Sensation. Koks galt schon damals als hochwertiger Brennstoff mit einem Heizwert von 7.000 kcal/kg, konnte bisher aber nur durch trockene Destillation aus Steinkohle gewonnen werden. Koks aus Oberdorfer Braunkohle? Das war eine Neuentwicklung, die man nicht den Polen Überlassen konnte! Also wurde bei der GKB kräftig investiert: Mit enormem Aufwand errichtete man in Oberdorf eine Verkokungsanlage. Sie bestand aus einem 37 Meter hohen gemauerten Ofengebäude, einem Laboratorium und einem Heizhaus. Die Kapazität der Anlage war auf vier bis sechs Waggonladungen Koks pro Drittel ausgelegt; 12 bis 15 Mann sollten für den Betrieb nötig sein.
Es war um 1924 und 1925, als man im Bergbauunternehmen GKB das aufsehenerregende Gerücht vernahm, man hätte in Polen aus Oberdorfer Kohle Koks hergestellt. Dies war nicht nur erstaunlich – es war eine Sensation. Koks galt schon damals als hochwertiger Brennstoff mit einem Heizwert von 7.000 kcal/kg, konnte bisher aber nur durch trockene Destillation aus Steinkohle gewonnen werden. Koks aus Oberdorfer Braunkohle? Das war eine Neuentwicklung, die man nicht den Polen Überlassen konnte! Also wurde bei der GKB kräftig investiert: Mit enormem Aufwand errichtete man in Oberdorf eine Verkokungsanlage. Sie bestand aus einem 37 Meter hohen gemauerten Ofengebäude, einem Laboratorium und einem Heizhaus. Die Kapazität der Anlage war auf vier bis sechs Waggonladungen Koks pro Drittel ausgelegt; 12 bis 15 Mann sollten für den Betrieb nötig sein.
Der Probebetrieb in der GKB-Kokerei dauerte fast zehn Monate. Aber wie man die weststeirische Braunkohle auch drehte und wendete, strapazierte und bearbeitete: Koks wurde nicht daraus.
Peinlich, peinlich für die investitionsfreudigen Kumpel bei der GKB. Erst gab man dem Ofen die Schuld an der Misere. Als man in diesem jedoch testweise Kohle aus Polen verarbeitete, funktionierte er perfekt. Woran also lag es?
Könnte es vielleicht sein, dass das Patent für die Kokerei (es stammte natürlich aus Polen) vielleicht doch nicht so ganz lupenrein war? Dass irgend jemand in jenem fernen Land sich jetzt die Hände rieb, weil er der großen GKB nicht nur ein völlig unbrauchbares Anlagenkonzept verkauft hatte, sondern zuletzt auch noch polnische Kohle? Man weiß es nicht. Der Gedanke, aus Oberdorfer Braunkohle Koks zu erzeugen, wurde von den Verantwortlichen im weststeirischen Revier jedenfalls ad acta gelegt.
Warnung:
So manch’ gedankliche Vision
führt zur Fehlinvestition!
8. Valentins längster Sonntag
 Da die Eisenwerke in den Tälern Holzkohle verwendeten und große Mengen davon brauchten, wurde an vielen Stellen der weststeirischen Almen mit der Holzkohlenerzeugung begonnen. Als im Laufe des 19. Jahrhunderts die Holzkohle durch die Braunkohle verdrängt wurde, gewannen die Holzbringung und -verarbeitung an Bedeutung. Holz wurde in kleinen, wasserkraftbetriebenen Sägewerken zu Brettern, Pfosten, Kanthölzern etc. verarbeitet.
Da die Eisenwerke in den Tälern Holzkohle verwendeten und große Mengen davon brauchten, wurde an vielen Stellen der weststeirischen Almen mit der Holzkohlenerzeugung begonnen. Als im Laufe des 19. Jahrhunderts die Holzkohle durch die Braunkohle verdrängt wurde, gewannen die Holzbringung und -verarbeitung an Bedeutung. Holz wurde in kleinen, wasserkraftbetriebenen Sägewerken zu Brettern, Pfosten, Kanthölzern etc. verarbeitet.
Zur Verwertung der enormen Holzreserven des sogenannten „Reiner Waldes“ wurde um die Jahrhundertwende nächst dem heutigen Forsthaus ein für die damalige Zeit supermodernes Sägewerk errichtet. Das dort geschnittene Holz wurde per Seilbahn (!) über den Petererriegel (1.962 m) nach Obdach transportiert. Diese Materialseilbahn wurde angeblich 1916 durch das Militär beschlagnahmt, abgebaut und an die Isonzofront transportiert. Zuvor aber sorgte sie für eine bemerkenswerte Anekdote:
Hauptdarsteller der Geschichte ist der Glaserer Valentin. Er zog umher und versorgte die Bauern mit Fensterscheiben und Gläsern. Und er gehörte zu denjenigen, die die Materialseilbahn – natürlich verbotenerweise – als Transportmittel über die Alm verwendeten. Als Valentin eines Samstags wieder einmal von Obdach über die Alm nach Hirschegg wollte, schwang er sich auf einen der Transportbügel – und schon ging die Reise dahin. Allerdings diesmal nicht weit. An einer der höchsten Stellen über dem Almboden blieb die Seilbahn stehen, das Sägewerk hatte soeben Feierabend gemacht …
Was tun?
Eisiger Wind pfiff dem Valentin um die Ohren, an Abspringen war nicht zu denken, das Seil schwankte beträchtlich, und Einschlafen konnte gefährlich werden. Der Glaserer durchlebte das längste Wochenende seines Lebens. Und wie man erzählt, lernte Valentin während seiner vermutlich letzten Fahrt mit der Materialseilbahn, obgleich er nicht als sonderlich „heilig“ galt, auch das Beten wieder. Was beweist:
Es muss sich oft der Abgrund zeigen,
um innerlich emporzusteigen!
9. Kuriose Typen
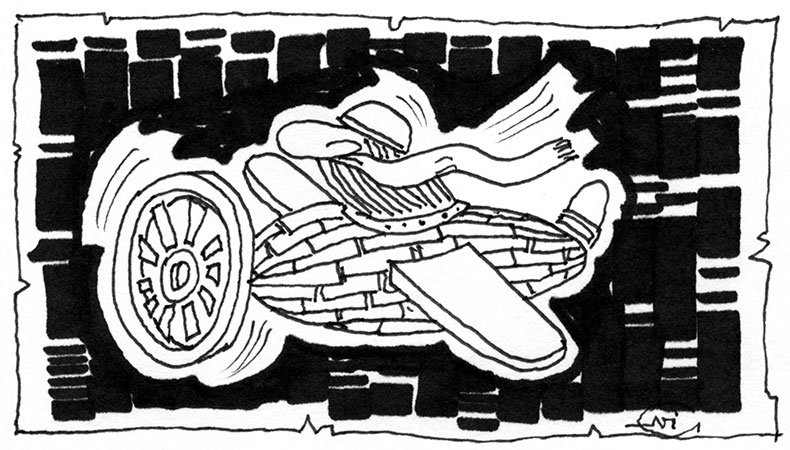 Der Glaser Valentin ist natürlich nicht die einzige urige Gestalt in der Geschichte des weststeirischen Kohlereviers. Im Gegenteil: Man weiß ja längst, dass unter den wilden Weststeirern – damals wie heute – kuriose Typen gehäuft auftreten.
Der Glaser Valentin ist natürlich nicht die einzige urige Gestalt in der Geschichte des weststeirischen Kohlereviers. Im Gegenteil: Man weiß ja längst, dass unter den wilden Weststeirern – damals wie heute – kuriose Typen gehäuft auftreten.
Man denke nur an den Hirschegger Landpfarrer Josef Nieß, der als kauziges Unikum weithin, bekannt war und selbst den einstigen Bischof Pawlikowski zu recht weltlichen Bemerkungen veranlasste.
Als dieser nämlich Pfarrer Nieß besuchte und munter den Klingelknopf an dessen Tür betätigte, sah er sich ob eines jäh auftretenden stechenden Schmerzes am Zeigefinger zu allerlei Ausrufen veranlasst. Pfarrer Nieß hatte den Klingelknopf durchbohrt und dahinter einen Reißnagel so montiert, dass man sich leicht stechen mußte …
Ein weiterer Lebenskünstler war der Köflacher „Schwara Bertl“. Als Zeichner, Maler und Unikum von lokaler Berühmtheit (einige seiner Arbeiten sind erhalten), beherrschte er auch die edle Kunst des Bauchredens – wobei er mit Vorliebe Leute foppte, die von seiner Fähigkeit nichts wussten …
Im Gasthaus Kleinhappl jagte der Schwara Bertl einmal einem Lankowitzer Gendarm Angst ein, nachdem dieser in Weinlaune selbstherrlich erzählt hatte, alle Leute würden vor ihm zittern: Der Schwara Bertl imitierte eine vor dem Gasthaus stehende Person, die den Gendarm aufforderte, herauszukommen, damit eine „offene Rechnung“ zwischen den beiden beglichen werden könne, so perfekt, daßss der wortgewaltige Gendarm zuletzt ängstlich eine Begleitung gegen Bezahlung für den Heimweg suchte. Dass Schwara die Rolle des Unbekannten vor dem Fenster gespielt hatte, war dem Gendarm in dieser nervenzerfetzenden Situation völlig entgangen …
Ein weiteres Köflacher Unikum war der Wagner Herk. Er und sein Vater betrieben in der Judenburger Straße neben der Glaserei Liebl-Holweg eine Wagnerei. Aber eben nicht nur das: Der junge Herk bezeichnete sich auch als Erfinder. Und was für einer er gewesen sein musste! So erzählte er immer wieder von seinem Flugzeug, das sich – angeblich – auf dem Dachboden seiner Werkstätte befand. Weiters war Wagner Herk – angeblich – im Besitz eines „Wunderlöschgerätes“, und: ach, es fehlte nur der richtige Großbrand, um es ausprobieren und einer staunenden Masse vorführen zu können; man könne, so Herk, ruhig die Stadt Köflach anzünden: mit seinem revolutionären Löschgerät würde er den Brand innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle haben. Zum Glück hatte Herks Kühnheit ihre Grenzen im Verbalen:
Wagner Herk blieb moderat
Das Schicksal Roms der Stadt erspart:
Auf’s Experiment hat er verzichtet,
Köflach wurde nicht vernichtet!
10. … und noch einmal Gold!
Wandert man von Hirschegg, Pongratzwirt, über die St.-Bartholomä-Kirche in Richtung Salzstiegel, so gelangt man auf die St. Leonharder Alm. Dort liegt – oberhalb der „Fellhütte“ in einer Seehöhe von über 1.800 Meter – das „Goldloch“: Oberflächlich betrachtet gleicht diese Bodenvertiefung einem Bombentrichter, doch man weiß so allerhand von diesem Loch. Es stellt ein weiteres Zeugnis für die unermüdliche Suche nach Bodenschätzen dar, die den Weststeirern wohl im Blut liegt und über die der Volksmund bis heute unzählige Geschichten erzählt …
Im „Goldloch“ soll vor langer Zeit nach Gold gegraben worden sein. So erinnert man sich noch an die sogenannten „Walen“ oder „Venedigermandeln“, die italienischen Erzsucher des Mittelalters. Ein Italiener sei dort tätig gewesen, und natürlich sei seine Suche erfolgreich gewesen. Er habe in der Nähe des „Goldloches“ gewohnt und geschürft, und er soll Hirschegg, nachdem er so viel Gold gefunden hatte, dass er und seine Familie zeit ihres Lebens damit auskommen würden, wieder in Richtung Italien verlassen haben …
Solche Erzählungen riefen natürlich immer wieder Nachahmer auf den Plan, das heißt: zum „Goldloch“. Der Fund goldgelber, in sandiges Gestein gelagerter Körner erregte die Gemüter der Beteiligten zusätzlich. Man brachte Proben nach Graz, Wien und Leoben und versuchte, möglichst viele dieser Körner an sich zu bringen, arbeitete verbissen weiter und sah sich schon als reicher Goldgrubenbesitzer.
Dann kamen die Untersuchungsergebnisse: Man hatte zwar „Gold“ gefunden, aber leider nur „Bauerngold“; die schönen goldgelben Körner entpuppten sich als Pyrit …
So bleibt nur eine Lehr’ zu ziehen,
(um nicht vergeblich sich zu mühen:)
Man beschränke seine Suche hier
Auf’s Braune Gold in dem Revier!

Hinweis: Diese zehn Anekdoten schrieb ich ursprünglich für das Magazin „format“ der GKB-Bergbau GmbH (diese von mir als Chefredakteur betreute Zeitschrift erschienen quartalsmäßig 1989 bis 1996). Alle inhaltlichen Ideen dazu stammen von Ernst Lasnik, der mich in vielen Gesprächen mit seinem ebenso umfangreichen wie lebendigen Geschichtswissen immer wieder verblüfft, vergnügt und zu den kurzen Aufsätzen inspiriert hat.
Die Grafiken zu den Bergbau-Anekdoten stammen aus der Feder von Nikolaus Trnka, der sich in mehreren Dokumentarfilmen, die von mir als Autor und Wolfgang Scherz als Regisseur betreut worden waren, auch als Schauspieler bewährte.




